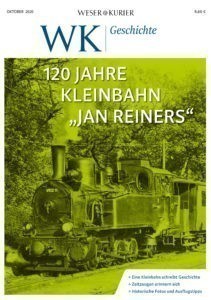Wie schwer der Schütting und das Börsengebäude (links vorne) durch den Bombenkrieg gelitten hatten, illustriert diese kurz nach Kriegsende entstandene Aufnahme.
Quelle: Handelskammer Bremen
Zum Zweiteiler „Unsere Städte nach ’45“: Bausünden und Stadtplanung in den Nachkriegsjahren
Schwer gelitten hat Bremen im Zweiten Weltkrieg. Zwei Drittel des Wohnraums fielen den Bomben zum Opfer, im Stephaniviertel stand kaum noch ein Stein auf dem anderen, wie eine apokalyptische Trümmerwüste wirkte der Bremer Westen. Doch den massiven Bombenschäden konnte der Architekt Hans Högg auch etwas Gutes abgewinnen. Wie „ein gewaltsamer Sanierungsabbruch“ habe die flächendeckende Vernichtung gewirkt, frohlockte er am 13. Dezember 1946 bei einem Vortrag in Bremen. Damit seien die Voraussetzungen für eine „große und grundlegende Regeneration“ geschaffen.
Tatsächlich räumten Architekten und Stadtplaner rigoros auf. Was schief und falsch gelaufen war in der Phase ungebremsten Wachstums im späten 19. Jahrhundert, wollten die Macher der Nachkriegsjahre beim Wiederaufbau korrigieren. Die Städte sollten wieder atmen können, Grünflächen sollten die Quartiere durchziehen, Wohn- und Industriegebiete strikt getrennt werden – eine „Stadtlandschaft“ sollte entstehen, wo zuvor nur ein wogendes Häusermeer war. „Die zu dichte Bebauung unserer Innenstädte werden wir auflockern“, verkündete Högg voller Zuversicht.
An sich kein schlechter Gedanke, die Prämissen moderner Stadtplanung nicht nur beim Bau neuer Stadtteile auf der sprichwörtlichen „grünen Wiese“ anzuwenden, sondern auch beim Wiederaufbau der zerstörten Stadtteile. Und doch hat gerade dieser Wiederaufbau in den 1950er und 1960er Jahren tiefe Wunden geschlagen.
Denn wo der „gewaltsame Sanierungsabbruch“ des Bombenkriegs nicht tabula rasa gemacht hatte, half man in den Nachkriegsjahren noch kräftig nach. Erst recht wenn es darum ging, Platz zu schaffen für Verkehrsschneisen rund um den Altstadtkern. Dabei blieben etliche Bauten auf der Strecke, die auf die eine oder andere Weise das überlieferte Stadtbild geprägt hatten. Nicht nur mittelalterliche Bausubstanz wie das Katharinenkloster oder die Ruine der St. Ansgarii-Kirche, sondern auch historistische Prachtbauten wie das Lloydgebäude und die Neue Börse.

Trauriger Anblick: die Ansgarii-Ruine und das schwer beschädigte Lloydgebäude in den frühen 1950er Jahren.
Bildvorlage: Nils Huschke
Viel Selbstbewusstsein bei Städteplanern
Schon einmal haben sich Radio Bremen-Autorin Susanne Brahms und Rainer Krause dieses Themas mit der Filmdokumentation „Die zweite Zerstörung“ angenommen. Einem Zweiteiler, der die Bausünden der Nachkriegsjahre in Bremen aufzeigte. Nun legen Brahms und Krause mit einem weiteren Zweiteiler nach, wobei sie diesmal unter dem Titel „Unsere Städte nach ’45“ das gleiche Phänomen nur in größerem Rahmen unter die Lupe nehmen. Neben Bremen rückt vor allem Hannover ins Blickfeld, hinzu kommen Beispiele aus Essen, Ulm sowie Görlitz und Bernau in der früheren DDR. Am vergangenen Montag lief der erste Teil zu später Stunde in der ARD, an diesem Montag folgt um 23.30 Uhr der zweite Teil.
An Selbstbewusstsein mangelte es den Städteplanern ganz gewiss nicht, das unterstreicht die Filmdokumentation am Beispiel von Stadtbaurat Rudolf Hillebrecht aus Hannover. Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ feierte ihn im Juni 1959 sogar mit einer Titelgeschichte. Den Wiederaufbau der niedersächsischen Landeshauptstadt pries das Magazin als „Wunder von Hannover“. Sein Verdienst: „Heute ist Hannover die einzige Stadt der Bundesrepublik mit einem System von Stadtautobahnen.“
Dass der charismatische Verkehrsplaner dafür verbliebene Reste von Altbausubstanz opferte, fiel nicht weiter ins Gewicht. Hillebrecht selbst konnte bis ins hohe Alter keinen Makel an seiner Städteplanung erkennen. Er war davon überzeugt, zum Wohle der Menschen gehandelt zu haben – sowohl durch den Bau von Verkehrsschneisen durch die Innenstadt als auch durch die Neukonzeption der Wohnbebauung.
Ein uneinsichtiger Betonkopf? Möglich, aber erklären kann das nichts. Bei aller berechtigten Kritik am Wiederaufbau der Nachkriegsjahre sollte man sich davor hüten, die Verantwortlichen zu dämonisieren. So zu tun, als sei es ihnen nur um die Erfüllung eigener Ambitionen gegangen. Und zwar ohne die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen im Blick zu haben. Von einem regelrechten „Hass auf alte Gebäude“ zu sprechen wie Ulrich Merkel von Critical Mass, einer Aktionsbewegung nicht-motorisierter Verkehrsteilnehmer, dürfte dann doch am Kern der Wahrheit vorbeigehen.
Die zerstörten Städte neu erfinden
Zur Wahrheit gehört eben auch, dass die Politik damals andere Schwerpunkte setzte. Der Wohnungsnot ein Ende zu bereiten, stand auf der Agenda ganz oben. Ebenso wie der Ehrgeiz, die zerstörten Städte noch einmal neu zu erfinden. Die Städte diesmal richtig zu bauen und nicht so chaotisch wie in den Gründerjahren. Dabei ging es nicht nur darum, dem Auto den Weg in die Innenstadt zu bahnen. Verfolgte man doch zugleich auch das Ziel, den Verkehr aus dem innersten Altstadtbereich herauszuholen. Die Erweiterung und Begradigung der Balgebrückstraße geschah unter der Prämisse, den Marktplatz östlich zu umgehen – die Straßenbahn und den Autoverkehr von der guten Stube fernzuhalten. Kein völlig abwegiger Vorsatz. Dass dafür die Petristraße geopfert wurde, nahm man billigend in Kauf. Zumal die Petristraße nicht etwa eine Gasse aus uralten Zeiten war, sondern ein Produkt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Das Ende: Abriss des Lloydgebäudes 1969, rechts im Hintergrund die Knochenhauerstraße mit dem Elektrokaufhaus Quelle.
Quelle: Staatsarchiv Bremen
Die Gelegenheit zum gründlich durchdachten Neustart wollte man sich nicht entgehen lassen. Zumal viele der Beteiligten in der legendären „Stunde Null“ keineswegs bei Null anfingen. In der Filmdokumentation kommt dieser Aspekt auch zum Tragen: Etliche Architekten brüteten schon in Kriegszeiten unter Albert Speer im „Arbeitsstab für den Wiederaufbau bombenzerstörter Städte“. Nach Kriegsende musste man oft genug die alten Pläne nur noch aus der Schublade holen. Freilich unter Verzicht auf nun nicht mehr benötigte Parteibauten.
Noch ein anderer Punkt verdient nähere Betrachtung. Denn beim Blick auf die Bausünden der Nachkriegsjahre droht die Nostalgiefalle. Nur allzu leicht verklärt man die historistischen Monumentalbauten der Kaiserzeit als ästhetisch wertvolle Zeugnisse vergangener Baukunst. Und vergisst dabei, dass auch diese Gebäude einmal Neubauten waren, die zumeist ohne die geringste Rücksicht auf städtebauliche Zusammenhänge errichtet wurden.

Das Ende: Auf der Balgebrückstraße sind im Sommer 1960 die Straßenbahnschienen schon verlegt, im Hintergrund ist der Torso des schon fast komplett abgerissenen Eckhauses Petristraße/Marktstraße zu sehen. Quelle: Stadtteilarchiv Neustadt
Für die Neue Börse wie auch das Gerichts- und Polizeigebäude mussten ganze Wohnquartiere weichen. „Immer brutaler und protziger machten sich die neuen Bauten breit“, konstatiert Landesdenkmalpfleger Georg Skalecki. Und ergänzt, um die Jahrhundertwende seien die Projekte „noch rücksichtsloser“ geworden. Als Beispiele nennt er die Baumwollbörse und das Lloydgebäude. Im Grunde war der damalige Bauwahn schon die erste Zerstörung und nicht der Bombenkrieg. Nach dieser Rechnung wären dann die Bausünden der Nachkriegsjahre nicht die zweite, sondern die dritte Zerstörung gewesen.
Auch Sensibilität für historische Bausubstanz
Es wäre auch nicht gerecht, den Städteplanern der Nachkriegsjahre jegliche Sensibilität für historische Bausubstanz abzusprechen. Freilich wurden meist nur ältere Gebäude aus der Zeit der Weserrenaissance als erhaltenswert eingestuft. Was den schwer beschädigten Schütting angeht, bestand von Anfang an ein breiter Konsens darüber, dieses Bauwerk als herausragendes Zeugnis früherer Baukunst wiederaufzubauen. Einig war man sich auch im Falle von Stadtwaage und Gewerbehaus, beide Gebäude sollten als Traditionsinseln der Nachwelt erhalten bleiben.
Anders bei den historistischen Bauten, die damals häufig erst 50 bis 60 Jahre alt waren. Kein Finger rührte sich für ihren Erhalt, sie hatten schlichtweg keine Lobby, weder in Experten- noch in Laienkreisen. Das galt auch für den ältesten historistischen Monumentalbau Bremens, der 1864 eingeweihten Neuen Börse von Heinrich Müller. Niemand weinte dem wuchtigen Gebäude eine Träne nach, als die Brandruine 1956 abgetragen wurde. Im Gegenteil, sogar die Gesellschaft Lüder von Bentheim atmete erleichtert auf, als das Börsengebäude verschwunden war und sah nun den Boden bereitet für eine Rekonstruktion der vorherigen Patrizierhäuser anstelle des geplanten Bürgerschaftsgebäudes.

Letzte Reste des Lloydgebäudes – und dahinter das Hertie-Gebäude, das auch schon längst Vergangenheit ist.
Quelle: Staatsarchiv Bremen
Auch beim Abriss des Lloydgebäudes regte sich kein Widerstand. Als Ausnahme können eigentlich nur die Bestrebungen gelten, die Ruine der Wilhadikirche in Walle zu bewahren. Für den Erhalt des neugotischen Bauwerks setzten sich in den späten 1950er Jahren Gemeindekreise ein. Allerdings ging es dabei weniger um das Bauwerk an sich, sondern vielmehr um den Wunsch, die Ruine als Mahnmal gegen den Bombenkrieg zu bewahren.
Proteste gegen den Abriss der Ansgarii-Ruine
Wirkliche Proteste gab es nur gegen den sukzessiven Abriss der Ansgarii-Ruine. Unter anderem von Johann Hinrich Prüser, den Bruder des Staatsarchivleiters Friedrich Prüser. Mit mehreren Eingaben wandte er sich 1951 an Bürgermeister Wilhelm Kaisen. Dabei ging es ihm auch um die Bergung von Fassadenteilen alter Patrizierhäuser aus dem Trümmerschutt. Doch der damalige Widerstand war eher akademischer Natur, mehr ein Vorstoß elitärer Kreise als eine Bewegung von unten.
Das änderte sich erst, als 1972 die „Mozarttrasse“ gebaut werden sollte. Zum damaligen Zeitpunkt durchschnitten schon drei Verkehrsachsen die Randbereiche von Alt- und Neustadt: die Neuenlander Straße als Südtangente, der Nordwestknoten als Westtangente und der Breitenweg als Nordtangente. Fehlte nur noch die „Mozarttrasse“ als Osttangente, die quer durch das Ostertorviertel verlaufen sollte.
Doch dazu kam es nicht mehr, weil eine Bürgerbewegung das Vorhaben zu Fall brachte. Dass diese Erfolgsgeschichte zivilen Ungehorsams im zweiten Teil der Filmdokumentation von Susanne Brahms und Rainer Krause offenbar nicht zum Zuge kommt, ist aus Bremer Sicht sehr zu bedauern. Stattdessen geht es um Bürgerproteste gegen städtebaulichen Kahlschlag in Hamburg, Köln, Bochum, Hannover, München, Erfurt und Regensburg. Aber auch das dürfte lehrreich und spannend sein.
von Frank Hethey
Programmhinweis: „Unsere Städte nach ’45“, 2. Teil: Abriss und Protest – Montag, 13. Februar 2017, ARD, 23.30 Uhr