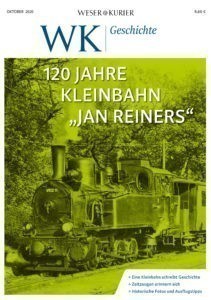Vor 100 Jahren: Die Skagerrak-Schlacht vom 31. Mai 1916
Das Echo in Bremen und Gorch Fock als prominentestes Opfer
Der Erfolgsschriftsteller war als Rekrut in der Neustadt einquartiert
Schon zu Beginn der Skagerrak-Schlacht am 31. Mai 1916 besiegelte sich das Schicksal der „Wiesbaden“. Ein Volltreffer im Maschinenraum machte den kleinen, aber immerhin 145 Meter langen Kreuzer manövrierunfähig, noch stundenlang dümpelte das erst ein knappes Jahr zuvor in Dienst gestellte Schiff mitten zwischen den Schlachtlinien. Ein dankbares, weil unbewegliches Ziel für die britische Flotte. Auch deshalb, weil die Besatzung den Kampf nicht einstellte, sondern weiterhin aus allen Rohren feuerte. Erst nach stundenlanger Agonie versank das „Heldenwrack“ (Jakob Kinau) in den frühen Morgenstunden des 1. Juni 1916 in den Fluten der Nordsee. Von der 589-köpfigen Besatzung konnten sich gerade mal 22 Mann auf Flöße retten, nur ein einziger überlebte das Drama.
Unter den Todesopfern war auch ein Mann, der heute so ziemlich in Vergessenheit geraten ist: Gorch Fock, mit bürgerlichem Namen Johann Kinau. Geläufig ist sein Künstler-Pseudonym eigentlich nur noch als Name des Segelschulschiffs der Bundesmarine. Doch dass sich dahinter ein Mensch aus Fleisch und Blut verbirgt und nicht etwa ein seemännischer Fachterminus, gilt heute schon fast als Expertenwissen.
Dabei war Gorch Fock kurz vor dem Ersten Weltkrieg ein gefeierter Bestsellerautor. Über eine halbe Million mal verkaufte sich sein Roman „Seefahrt ist not“, eine stark autobiografisch geprägte Geschichte von einem Hochseefischer aus Finkenwerder, der ausgerechnet im Skagerrak untergeht.
Die Skagerrak-Schlacht vor 100 Jahren, auf britischer Seite als „Battle of Jutland“ bekannt, hielt wochenlang die Welt in Atem. Auch an der Weser sorgte die Seeschlacht mit insgesamt knapp 9000 Toten für reichlich Schlagzeilen.
Die Weser-Zeitung titelte: „Großer Seesieg vor der Westküste Jütlands“
Erste Einzelheiten über ihren Ausgang erfuhren die Bremer am 2. Juni 1916. In ihrer Mittagsausgabe berichtete die Weser-Zeitung in großer Aufmachung über das Geschehen. Die Überschrift ließ keinen Zweifel daran, wer als Sieger zu betrachten sei. „Großer Seesieg vor der Westküste Jütlands“, titelte die damals größte und einflussreichste Bremer Tageszeitung. Eine Auflistung der verlorenen Schiffe auf beiden Seiten schien für sich zu sprechen. Weil die britische Flotte mehr Verluste zu beklagen hatte, kam die Weser-Zeitung zu dem Schluss, ein „glänzender deutscher Seesieg“ sei errungen worden.

Sieg auf ganzer Linie: Schlagzeile der Weser-Zeitung vom 2. Juni 1916.
Quelle: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
In der nachfolgenden Berichterstattung erhielt diese Lesart dann gleichsam den Siegel des Amtlichen. Wann immer neue Details durchsickerten, wurden diese in einer eigenen Rubrik unter der Überschrift „Unser Seesieg im Skagerrak“ oder wahlweise auch „Unser Seesieg in der Nordsee“ abgedruckt. Wer konnte da noch Zweifel hegen an dem Triumph der deutschen Waffen?
Freilich reklamierten auch die Engländer den Sieg für sich. Nur weil man die deutsche Flotte habe entkommen lassen, sei ihr eine vernichtende Niederlage erspart geblieben, räsonierte man auf der Insel. In Anspielung auf die Zerstörung der französischen Flotte 1805 vor der spanischen Küste erklärte der beteiligte Admiral Beatty sogar, die Chance auf ein „zweites Trafalgar“ sei leichtfertig vertan worden.
Davon wollte man in Deutschland natürlich nichts wissen. Und schon gar nicht an der Weser. Die Bremer Handelskammer sprach Flottenchef Scheer die „wärmsten Glückwünsche aus zu dem gewaltigen Siege“ und betonte, als „Stadt der Seefahrer“ fühle sich Bremen „auf das Engste verbunden mit den tapferen Kämpfern der deutschen Hochseeflotte“.
„Bremens Dank an die Flotte“
Doch es blieb nicht nur bei warmen Worten. Als „Bremens Dank an die Flotte“ rief der Zentral-Hilfs-Ausschuss am 3. Juni 1916 dazu auf, den siegreichen Marinesoldaten eine „würdige Liebesgabe“ darzubringen.
Was heute leicht verfänglich klingt, war damals das gebräuchliche Wort für eine Kriegsspende. Konkret schwebte dem Ausschuss ein „Rauchopfer“ vor, man wollte eine erkleckliche Menge Tabakwaren nach Wilhelmshaven schicken. Ein Unterfangen, das offenbar auf offene Ohren stieß. Zehn Tage später meldete die Weser-Zeitung, es seien 90.000 Zigarren und 180.000 Zigaretten an den Stützpunkt überstellt worden.
In bester Laune war auch der Kaiser, als er am 5. Juni 1916 bei seiner Rückkehr aus Wilhelmshaven eine kurze Zwischenstation in Bremen einlegte. „Der Kaiser sah sehr wohl aus und war in ausgezeichneter Stimmung“, berichtete geflissentlich die Weser-Zeitung. Ein durchaus verständlicher Enthusiasmus. Man darf nicht vergessen, die Marine war immer sein liebstes Kind gewesen, in seiner Herrschaftszeit erlebte sie einen ungeheuren Zugewinn an Prestige. War die erste deutsche Flotte von 1848 noch eher eine Lachnummer gewesen, so brachte die massive Aufrüstung zur See ab 1898 die traditionelle englische Vorherrschaft auf den Weltmeeren ernsthaft ins Wanken.
Und nun also der „erste gewaltige Hammerschlag“ gegen die britische Flotte, wie Wilhelm II. in Wilhelmshaven frohlockte. Gegen die „gewaltige Flotte des meerbeherrschenden Albions, das seit Trafalgar 100 Jahre lang über die ganze Welt den Bann der Seetyrannei gelegt“ habe.
Eine „kernige Festrede“ am Ehrenabend für die Skagerrak-Kämpfer
Ähnliche Töne auch beim „Ehrenabend“, den der Senat in den Centralhallen an der Düsternstraße am 14. Juni 1916 für die in Bremen anwesenden „Mitkämpfer der siegreichen Seeschlacht in der Nordsee“ veranstaltete. Dabei hielt der Vorsitzende des Landeskriegerverbandes nicht nur eine „kernige Festrede“, passend dazu machten auch die „tapferen blauen Jungen“ ganz den Eindruck von „frischen, kernigen Gestalten“. Patriotisch zeigte sich nicht zuletzt Emil Fritz, der Betreiber des bekannten Astoria-Varietés an der Katharinenstraße, indem er sein Künstlerpersonal für den Unterhaltungsabend zur Verfügung stellte.

Was fürs Auge: Für ihre Leser steuerte die Weser-Zeitung eine damals eher seltene Illustration auf der Titelseite bei.
Quelle: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
Und Gorch Fock, was hätte er gesagt?
Mit einem heute nur noch schwer erträglichen Pathos hatte er den Kriegsausbruch euphorisch bejubelt. Auch als frisch gebackener Rekrut stimmte er martialische Töne an. Das übrigens in Bremen, das er nicht in allzu guter Erinnerung hatte. „Am wenigstens zu mir selber gekommen bin ich in Bremen“, schrieb er über seinen zehnmonatigen Aufenthalt 1900/01 als Handlungsgehilfe der Firma Lexzau & Scharbau an der Langenstraße.
Ganz anders nun in der Neustädter Kaserne, wo er von April bis Juli 1915 seine Grundausbildung zu absolvieren hatte. Als man ihn im ersten Quartier im Schützenhof an der Pappelstraße erkannte und um ein paar erhebende Worte bat, zierte er sich nicht lange – und zitierte sich selbst. In der dritten Person berichtet der 34-Jährige davon: „Und dann mußte er sofort im Saal auf einen Tisch springen und seine Kriegsgedichte sprechen, was er mit einer Theodor Körner Stimmung tat.“ Der Dichter der Befreiungskriege gegen Napoleon als Bruder im Geiste. Die Verbindung von Leier und Schwert, das dürfte auch sein Ideal gewesen sein.
Doch schon sehr bald nach den ersten Fronterlebnissen im Osten mischten sich auch nachdenkliche Töne in seine Aufzeichnungen.
Der Krieg als Katharsis, als reinigendes Stahlgewitter? Unter Intellektuellen damals ein beliebtes Motiv, man erhoffte sich vom Massengemetzel eine geistige Wiedergeburt der Nation, einen Neuanfang auf allen Ebenen. Und dann die Konfrontation mit der Wirklichkeit des Krieges, als Gorch Fock die ersten Leichen zu Gesicht bekommt. Gründlich desillusioniert schrieb er am 4. August 1915 an seine Muse Aline Bußmann: „Gestern – im fahlen Mondlicht ein toter Russe, mit geballten Fäusten auf dem Rücken liegend, Gehirnschuß, weite, offene Augen, eine furchtbare Anklage gegen allen Krieg.“
Gorck Fock konstatierte eine verbreitete Kriegsmüdigkeit
Schon damals, gerade einmal ein Jahr nach Kriegsausbruch, konstatierte Gorch Fock eine verbreitete Kriegsmüdigkeit unter den Soldaten, sie „möchten so gern heim, alle, alle!“ Das Heer habe Heimweh, stellte er unumwunden fest. Das klang ganz anders als noch kurz zuvor, ganz anders auch als der markige Gorch Fock, der posthum im „Dritten Reich“ propagiert wurde.

„Heldentod fürs Vaterland“: die ersten Todesanzeigen in der Weser-Zeitung vom 7. Juni 1916.
Quelle: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
Seine überraschende Distanz zum profanen Kriegsgeschehen hatte auch Gründe, die mit seiner Persönlichkeit zusammenhängen. Ein kriegslüsterner Draufgänger ist er nie gewesen. Kein rauer Gesell’, der sich mit den Kameraden verbrüdert hätte, weder in der Kaserne noch an der Front. Dafür war er viel zu sensibel, viel zu sehr Kopfmensch.
Keine guten Voraussetzungen für den soldatischen Korpsgeist, für die „Schicksalsgemeinschaft“ im Schützengraben. Die „vielgesagte Kameradschaft im Felde“ suche er „noch wie die blaue Wunderblume des Novalis“, schrieb er am 21. August 1915. Das oft beschworene „Kriegserlebnis“ als Gemeinschaftserlebnis ist ihm fremd geblieben.
Im Grunde war ihm wohl auch völlig klar, dass er für den bewaffneten Kampf nur bedingt taugte. Schon von seinem Vater als nicht „seefest“ befunden – womit mehr gemeint war als nur der Hang zur Seekrankheit – , war er in Anbetracht seiner nicht gerade robusten körperlichen Konstitution wahrlich kein geborener Krieger. Das erkannte auch sein Bremer Vorgesetzter, der lieber seine geistigen Fähigkeiten in Anspruch nehmen wollte als ihn dem Kasernendrill auszusetzen. Doch es wurde nichts aus dem Plan, eine Geschichte des Hanseatischen Infanterie-Regiments Nr. 75 zu Papier zu bringen.
„Weh dem, der aus diesem Kriege ungesegnet in die Heimat zurückkehrt!“
Gleichwohl war Gorch Fock alles andere als ein verkappter Pazifist. „Weh dem, der aus diesem Kriege ungesegnet in die Heimat zurückkehrt!“ deklamierte er im September 1915 – ein Spruch, der ihm bis heute nachhängt. Die Grausamkeit des Krieges anzuerkennen heißt eben noch lange nicht, dem Kampf abzuschwören. Für ihn wie auch für viele andere Zeitgenossen bestand nicht der geringste Zweifel daran, dass die Auseinandersetzung nach Kriegsende fortgesetzt werden müsse. Nur dann mit geistigen Waffen statt physischer Gewalt. „Diese deutsche Welt ist doch noch viel gewaltiger und siegreicher als unsre Geschütze und andern Waffen.“
Nach seinem Einsatz im Osten landete Gorch Fock an der Westfront – in der berüchtigten Knochenmühle von Verdun. Im Februar 1916 hatte die Schlacht begonnen, vielleicht für ihn der letzte Anstoß, um seine Versetzung zur Marine zu bitten. Das dürfte ihm nur dank guter Beziehungen gelungen sein, der Erfolgsschriftsteller hatte prominente Fürsprecher.
Ob er damit seinen Frieden im Krieg machen wollte? Immerhin war der Krieg an der Marine bis dahin weitgehend vorbeigegangen, außer ein paar Scharmützeln hatte es keinerlei nennenswerte Seegefechte gegeben. Und dann als notorisch Seekranker bei der Marine? Auch noch hoch oben als Ausguck im vorderen Mastkorb, im „Krähennest“? Über diesen merkwürdigen Widerspruch schweigen sich die meisten Gorch Fock-Biografen aus. Wirklich passend ist das nicht, es passt allenfalls zu seinem Image als maritimer Dichter.
Vom Krieg genug gesehen?
Sicher ist, seine Kriegsbegeisterung hielt sich in Grenzen kurz bevor er den „Heldentod“ starb. Von einem achttägigen Heimaturlaub erst am 28. Mai 1916 nach Wilhelmshaven zurückgekehrt, hatte er noch bei weitem nicht genug von seiner Auszeit. Und das lag keineswegs nur an Frau und Kindern. In sein Tagebuch schrieb er: „Ich muss Urlaub haben, ich muss mich darum bemühen, acht Wochen möchte ich haben und schreiben – schreiben.“ Gegen den Krieg hätte er ganz gewiss nicht das Wort ergriffen. Doch offenbar war er der Meinung, vom Krieg genug gesehen zu haben, um sich darüber kompetent äußern zu können. Als Kämpfer mit der Feder, nicht mit dem Schwert.

Prahlen mit den Verlusten der anderen: Titelseite der Weser-Zeitung vom 7. Juni 1916.
Quelle: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
Sein nationalistisches, auch völkisches Bekenntnis hat es der Nachwelt leicht gemacht, ihn als deutschen Heroen zu deuten. Im „Dritten Reich“ setzte eine wahre Gorch-Fock-Renaissance ein, seine Werke gingen zu Hunderttausenden über den Ladentisch. Kein Zufall auch, dass bereits 1933 das neue Segelschulschiff der Reichsmarine seinen Namen erhielt.
Zur Heldenverklärung trug nicht unwesentlich sein ebenfalls dichtender Bruder Jakob Kinau bei. Mit viel Eifer strickte der an der Heldenlegende, wobei die Skagerrak-Schlacht natürlich eine bedeutende Rolle spielte. „Im ‚Krähennest’ stand ein Matrose und verfolgte mit leuchtenden Augen die Schlacht“, fabulierte er im Gorch Fock-Heimatbuch von 1937 über die letzten Stunden seines Bruders. Der sei „in der Schwimmweste treibend mit Hunderten seiner Bordkameraden ertrunken“, erklärte er im Duktus des allwissenden Erzählers.
Unklare Todesumstände
Ein qualvoller, aber irgendwie doch süßer Heldentod? In Wahrheit weiß man nichts über sein Tun und Lassen in der Skagerrak-Schlacht, es ließ sich auch nicht feststellen, unter welchen Umständen Gorch Fock ums Leben kam. Gut möglich, dass er gar nicht ertrunken ist, sondern schon an Bord tödliche Verletzungen erlitt. Oder den Tod fand, als der Fockmast getroffen wurde und ins Meer stürzte. Vorausgesetzt, er befand sich zu diesem Zeitpunkt überhaupt auf seinem Aussichtsposten.
Wie man es auch dreht und wendet, über seine Todesumstände lassen sich nur Mutmaßungen anstellen. Der einzige Überlebende der „Wiesbaden“ hatte keinerlei Erkenntnisse beizusteuern und als die Leiche Gorch Focks einen Monat später an den Strand einer schwedischen Schäreninsel vor Göteborg gespült wurde, war sie begreiflicherweise nicht mehr in einem Zustand, der noch nähere Aufschlüsse über die Todesursache erlaubt hätte. Identifiziert werden konnte sie nur aufgrund der Erkennungsmarke.
In den Tagen und Wochen nach der Skagerrak-Schlacht mussten sich nicht nur Strandspaziergänger auf angeschwemmte Leichen gefasst machen. Auch Fischkutter und Handelsschiffe hatten mit den Folgen des Seegemetzels zu kämpfen. Die Weser-Zeitung meldete am 8. Juni 1916, umhertreibende Wrackteile bildeten ein gefährliches Hindernis für den Schiffsverkehr nach Skandinavien. Noch eine Woche nach Ende der Schlacht wurde ein brennendes englisches Torpedoboot gesichtet.
Es begann das große Aufräumen, der Kriegsalltag kehrte zurück.
Von begrenzter Dauer war auch die Euphorie des Kaisers. Schon sehr bald musste er sich eingestehen, dass die Skagerrak-Schlacht nicht den erhofften Durchbruch gebracht hatte. Im Grunde blieb alles beim alten: Die britische Seeblockade war ungebrochen, die kaiserliche Hochseeflotte abermals zur Untätigkeit verurteilt.
Bereits im Juli 1916 war klar, dass die Flotte den entscheidenden Schlag nicht führen konnte. Des Kaisers neue Hoffnung: der uneingeschränkte U-Boot-Krieg. Der dann 1917 den Ausschlag für den Kriegseintritt der Amerikaner gab und damit das Kräfteverhältnis entscheidend zugunsten der Alliierten verschob.
von Frank Hethey