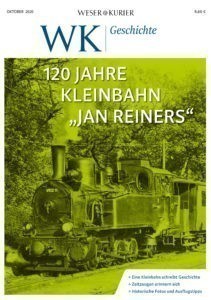Unbegleitete jugendliche Flüchtlinge gab es auch in den frühen Nachkriegsjahren / Politik forderte „Kampf gegen Jugendverwahrlosung“
In den frühen Nachkriegsjahren waren sie ein gängiges Erscheinungsbild auf den Straßen: eltern- und heimatlose Jugendliche. Nicht immer wurden ihnen viel Verständnis zuteil. „Zügellos, rauflustig, sittenlos, so tritt uns die entwurzelte, heimatlose Jugend heute entgegen“, schimpfte im Oktober 1945 die Leiterin der Flüchtlingsfürsorge. Dabei waren die unbegleiteten Jugendlichen von damals nur ein kleiner Teil des ganzen Problems.
Seine Familie hatte der 15-Jährige aus Danzig bei den Kämpfen um die Stadt aus den Augen verloren. „Wo meine Eltern und Geschwister geblieben sind, weiß ich nicht“, berichtete er im November 1945. Auf verschlungenen

Auf dem Sprung: Kinder als Kohlendiebe 1948.
Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-R68236 / CC-BY-SA 3.0 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-R68236,_Hamburg,_Kohlendiebe,_Kinder_verstecken_sich.jpg), „Bundesarchiv Bild 183-R68236, Hamburg, Kohlendiebe, Kinder verstecken sich“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode
Wegen war er nach Bremen gelangt. Und besaß jetzt nichts mehr außer dem, was er am Leibe trug. „Geld habe ich auch nicht mehr“, so sein ernüchterndes Fazit. Kaum besser erging es einer Gleichaltrigen aus Köln, die wegen der Bombengefahr nach Thüringen evakuiert und dort von ihrer Mutter getrennt worden war. Für sie war Bremen eine reine Durchgangsstation. „Ich bin jetzt auf der Reise nach Bochum und hoffe, meinen Vater dort zu finden.“
Zu Zigtausenden zogen sie in den ersten Nachkriegsjahren als Opfer der Kriegswirren durch Deutschland: unbegleitete Jugendliche, die auf der Suche nach ihren Angehörigen waren. Oder einfach nur ziellos umherirrten. Freilich nannte man sie anders, man sprach von eltern- und heimatlosen Jugendlichen. Und die waren durch Kriegs- und Fluchterlebnisse oft genug schwer traumatisiert. Eine Notsituation, die schon damals die Politik auf den Plan rief. Zugleich aber dazu angetan war, nicht nur Schutzinstinkte zu wecken.
Ausgerechnet die Leiterin der Flüchtlingsfürsorge konnte nur schwer an sich halten, als sie auf unbegleitete Jugendliche zu sprechen kam. „Zügellos, rauflustig, sittenlos, so tritt uns die entwurzelte, heimatlose Jugend heute entgegen“, lautete ihr vernichtendes Urteil im Oktober 1945. Was Maria Rüthnick partout nicht in den Kopf gehen wollte, war die Mentalität ihrer Schutzbefohlenen. Viele von ihnen machten den Eindruck, als seien sie „gänzlich unbeschwert“. Mehr noch, als würden sie sogar „Gefallen an diesem Vagabundenleben“ finden.
Der „kurze Sommer der Anarchie“
Neuerdings macht das Wort vom „kurzen Sommer der Anarchie“ die Runde, wenn es um die Stimmungslage unmittelbar nach Kriegsende geht. Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene genossen ihre neuen Freiheiten, gerieten mitunter sogar in einen euphorischen Taumel. Endlich war Schluss mit der ständigen Gängelei durch einen Staat, der die vollkommene Kontrolle seiner Jugend angestrebt hatte. Endlich konnte man als junger Mensch wieder Mensch sein, konnte man Grenzen überschreiten, ohne gleich um sein Leben fürchten zu müssen.
Schon in den letzten Kriegsjahren war die Jugendkriminalität rasant angestiegen. Ein bemerkenswertes Phänomen angesichts des harschen Strafkatalogs im NS-Staat. Nach der Kapitulation kamen Jugendliche dann öfter immer in Konflikt mit dem Gesetz. Ob durch Betrug, Raubtaten, Unterschlagungen oder Schwarzhandel – jugendliche Straftäter mischten kräftig mit im illegalen Sektor, vor allem bei Eigentumsdelikten war ihr Anteil beachtlich.
Kaum verwunderlich, dass unbegleitete Jugendliche besonders anfällig waren für kriminelle Versuchungen. Zumal in den frühen Nachkriegsjahren staatlicherseits nur völlig unzureichende Unterstützung angeboten werden konnte. Oft genug reichte es gerade mal für eine zeitlich äußerst limitierte, notdürftige Versorgung mit Lebensmitteln und einem Dach über dem Kopf. Im Herbst 1945 waren minderjährige Flüchtlinge nach nur drei Tagen staatlicher Fürsorge schon wieder auf sich allein gestellt. „Sorgen wir wenigstens dafür, daß sie einigermaßen versorgt weiterziehen können“, lautete ein hilfloser Appell im Weser-Kurier.
Nicht nur umherziehende Jugendliche galten als Problemfall
Bei alledem darf nicht vergessen werden, dass nicht nur umherziehende minderjährige Flüchtlinge als Problemfall wahrgenommen wurden. Auch einheimische Jugendliche mussten häufig ohne ihre Väter auskommen, die gefallen waren, vermisst wurden oder sich noch in Kriegsgefangenschaft befanden. Die ganze Verantwortung lastete auf den Müttern, die noch dazu alle Hände voll zu tun hatten, um für den Lebensunterhalt ihrer Zöglinge zu sorgen. Die Folge: Vielfach blieb der Nachwuchs tagsüber sich selbst überlassen. Und kam so fast naturgemäß auf dumme Gedanken.

Alle packten mit an: Beim Kohlenklau war die ganze Familie beteiligt.
Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-R70463 / CC-BY-SA 3.0 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-R70463,_Britische_Zone,_Kohlendiebe.jpg), „Bundesarchiv Bild 183-R70463, Britische Zone, Kohlendiebe“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode
Dabei dürften sich die Jugendlichen auch an den Erwachsenen orientiert haben. Lebten die doch vor, wie man sich in prekärer Lage zurechtfindet. Das galt nicht nur für das tägliche Ernährungsproblem, sondern spätestens ab Herbst 1945 auch für die Frage, wie die Unterkunft zu beheizen sei. Reihenweise mussten Bäume im Bürgerpark dran glauben, der Kohlenklau wurde zum „Volkssport“. Moralisch legitimiert durch den Kölner Kardinal Joseph Frings, der den Brennstoffdiebstahl in seiner Silvesterpredigt 1946 als entschuldbaren „Mundraub“ absegnete. Bezeichnend genug, dass der Volksmund beschönigend von „organisieren“ sprach.
Unter solchen Umständen verschwammen die Grenzen zwischen mein und dein, zwischen Recht und Unrecht. Im März 1946 schnappte die Polizei bei Karstadt eine Mutter, die ihre beiden 13- und 16-jährigen Kinder zu Taschendiebstählen und Hehlerei angestiftet hatte. Im Weser-Kurier hieß es dazu, von den entwendeten Lebensmittelmarken hätten Mutter und Kinder längere Zeit gezehrt.
Prostitution auch unter Jugendlichen
Sprunghaft stiegen auch die von der US-Militärregierung registrierten Fälle von Prostitution an, auch unter Minderjährigen. Das war gemeint, wenn die Politik verklausuliert von der „Gefährdung der weiblichen Jugend“ sprach. Von einem „Fräuleinkarussell“ vor der Glocke, damals eine Versorgungseinrichtung der US-Army, spricht Bestsellerautor Mario Puzo in seinem Roman Die dunkle Arena. „Die GIs lungerten herum und beäugten die Frauen und die ‚Fräuleins‘, die langsam vorbeidefilierten.“ Das viel beschworene „Fräuleinwunder“ – es war nicht nur das Ergebnis sexueller Selbstbestimmung. Sondern ebenso der Verkauf des eigenen Körpers, um hungrige Mäuler zu stopfen oder den tristen Lebensbedingungen zu entrinnen.
Gegen Diebstahlsdelikte von Erwachsenen mochte die Härte des Gesetzes helfen. Doch bei Jugendlichen fühlte sich die Politik gefordert, es ging um erzieherische Verantwortung. Doch was tun zur Bekämpfung der „Jugendverwahrlosung“, nicht zuletzt unter den eltern- und heimatlosen Jugendlichen? Neue Verordnungen und Vorschriften seien zweck- und wirkungslos, betonten Bremer Jugendpolitiker im Januar 1946. Nur geeignete Heime könnten helfen, „die gefährdete Jugend unterzubringen und zu erziehen“. Freilich haperte es gerade daran. Das Jugendwohnheim in den Baracken am Halmerweg in Gröpelingen war da nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Aber was sonst, wie der Situation begegnen? Die Leiterin der Flüchtlingsfürsorge, Maria Rüthnick, war sich sicher: „Nur die besten und charaktervollsten dieser Jugendlichen werden der großen Gefahr, der sie zur Zeit durch ihren Lebenswandel ausgesetzt sind, nach einiger Zeit entgehen und wieder auf einen geraden Weg kommen.“ Harte Worte, die fast ein bisschen klangen wie ehedem.
Mit der Konsolidierung der Verhältnisse, dem relativ raschen Wiederaufbau in den Zeiten des „Wirtschaftswunders“, löste sich das Problem der gefürchteten „Jugendverwahrlosung“ im Laufe weniger Jahre von selbst. Zehn Jahre später sah sich die Öffentlichkeit mit einem ganz anderen Phänomen konfrontiert. Es ging nicht mehr um Existenzkampf, sondern um Rebellion gegen erstarrte Strukturen, um Rebellion gegen die Elterngeneration. Und die reagierte mit unverhohlener Hau-drauf-Mentalität. „Die Halbstarken von heute, das ist die HJ des Wirtschaftswunderlandes“, war 1956 in der Deutschen Tagespost zu lesen. „Sie terrorisieren uns, weil wir nicht mehr so viel Mark in den Knochen haben, dass wir dem moralischen Nihilismus ein Gran Autorität und eine feste Hand zu zeigen wagen.“
von Frank Hethey