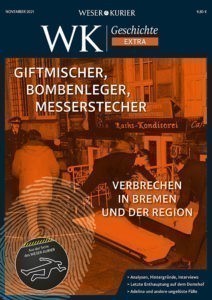Vor 110 Jahren: Fünf Tage nach dem Untergang des Atlantikliners war die „Bremen“ am 20. April 1912 vor Ort
Was Johanna Stunke am Nachmittag des 20. April 1912 erblickte, schien zunächst ganz harmlos zu sein – ein glitzernder Eisberg in der Sonne. Doch als die „Bremen“ sich näherte, stockte den Passagieren der Atem. Im Wasser trieben Leichen: eine Frau im Nachthemd mit einem Baby an der Brust. Und noch eine andere Frau, „voll angezogen, die Arme um den Körper eines zotteligen Hundes gelegt“. Dann drei Männer, die sich an einen Deckstuhl geklammert hatten. Noch viele weitere Leichen seien in ihren weißen Schwimmwesten zu sehen gewesen. „Einige der weiblichen Passagiere schrien und waren der Ohnmacht nahe, als sie sich von der Reling abwandten.“

Aufbruch nach New York am 10. April 1912: Es war die erste und letzte Fahrt der „Titanic“.
Quelle: Frei
Fünf Tage nach dem Untergang der „Titanic“ passierte die „Bremen“ (mehr dazu hier) das Unglücksgebiet. Der Dampfer des Norddeutschen Lloyd war auf dem Weg von Bremerhaven nach New York. Nach seiner Ankunft am 24. April schilderten die Passagiere der Presse, was sie gesehen hatten. Auch Kapitän Wilhelm gab bereitwillig Auskunft, nach seiner Schätzung befanden sich 150 bis 200 Leichen im Wasser: Männer, Frauen und Kinder, alle hätten Schwimmwesten getragen. Seine drastische Formulierung: „Das Schiff pflügte durch Leichenfelder, die Körper waren überall.“
Ein Kind in jedem Arm
Auch in Bremen wusste man alsbald Bescheid, die Weser-Zeitung gab die Meldungen der britischen und amerikanischen Zeitungen in der Mittagsausgabe vom 25. April 1912 wieder. Freilich mit dem Unterschied, dass die weibliche Leiche „in jedem Arm ein Kind“ gehalten habe. Und nicht nur einige, sondern viele Frauen hätten bei dem grausigen Anblick laut aufgeschrien. Zur Frage, warum die „Bremen“ die Toten nicht geborgen hatte, erklärte die Zeitung, der in der Nähe befindliche Dampfer „MacKay-Bennett“ habe signalisiert, er sei mit dem Einsammeln der Leichen beschäftigt.
Tatsächlich war die „Bremen“ kurz vor dem Bergungsschiff am Ort des Geschehens eingetroffen. Die Reederei der „Titanic“, die White Star Line, hatte den Kabeldampfer aus dem kanadischen Halifax beauftragt, nach den Toten des Unglücks zu suchen. Schwer beladen mit mehr als 100 Särgen, zahlreichen Leichensäcken, tonnenweise Eis zum Konservieren und Flüssigkeit zum Einbalsamieren erreichte die „MacKay-Bennett“ nach dreitägiger Fahrt am Abend des 20. April die Unglücksstelle.
Tags darauf begann der Kabeldampfer mit seiner Tätigkeit. Aufmerksam verfolgte die Weser-Zeitung den Fortgang der Bergungsarbeiten. Die „Mackay“ habe 64 Leichen der „Titanic“ aus dem Meer gefischt, erfuhr die Leserschaft am 22. April. Sie seien noch so gut erhalten gewesen, dass ihre Identifizierung keine Probleme bereitet habe. „Die Leichen, die nicht mehr zu identifizieren sind, werden im Meere bestattet“, hieß es einen Tag später.

War auf der Australien- wie auch Atlantik-Route im Einsatz: der Barbarossa-Dampfer „Bremen“, hier am NDL-Pier in Hoboken gegenüber von New York.
Quelle: Library of Congress
Bis heute Spekulationen
Unter Titanic-Enthusiasten gibt es bis heute Spekulationen, die „Bremen“ habe das Leichen- und Trümmerfeld absichtlich angesteuert. Andere Schiffe hätten die Unglücksstelle im großen Bogen umfahren. Als Grund gilt der harte Konkurrenzkampf auf der Atlantikroute, der Norddeutsche Lloyd habe die White Star Line vor den Augen der Weltöffentlichkeit kompromittieren wollen.
Dieser Verdacht lässt sich allerdings kaum erhärten. Johanna Stunke berichtete, Offiziere hätten die Passagiere unterrichtet, die „Bremen“ werde die letzte bekannte Position der „Titanic“ in einem Abstand von ein paar Meilen passieren. Das klingt nicht so, als sei die Unglücksstelle direkt angelaufen worden. Zumal man allenfalls grob ermessen konnte, wie sich Wind und Strömung auf treibende Überreste auswirken würden.
In den ersten Verlautbarungen des Norddeutschen Lloyd ist keine Spur von Häme zu erkennen. Im Gegenteil, die White Star Line wurde sogar als eng befreundete Reederei bezeichnet. In einer langen Mitteilung bekundete der Lloyd sein Mitgefühl und ordnete an, sämtliche Schiffe diesseits und jenseits des Ozeans hätten zum Zeichen der Trauer halbmast zu flaggen.

Ein monumentaler Prachtbau: das neue Verwaltungsgebäude des Norddeutschen Lloyd. Quelle: Privat
Doch nicht nur die makabre Passage der „Bremen“ durch das Leichen- und Trümmerfeld der „Titanic“ verbindet die Weserstadt mit der Katastrophe. Für einigen Wirbel sorgte auch der Vorwurf, ein anderer Dampfer des Norddeutschen Lloyd habe das Hilfegesuch der „Titanic“ ignoriert oder jedenfalls nicht angemessen reagiert. Gemeint ist die „Frankfurt“, die sich in der Unglücksnacht auf dem Rückweg vom texanischen Galveston nach Bremerhaven befand.
Erhoben hat den Vorwurf der zweite Funker der „Titanic“, Harold Bride. Bei seiner Anhörung vor dem unverzüglich eingesetzten Untersuchungsausschuss in New York erklärte der damals 22-Jährige, die „Frankfurt“ habe zwar als erstes Schiff auf den Notruf geantwortet. Bride hielt seinen Kollegen aber für inkompetent, weil der sich trotz des eindeutigen Morsecodes CQD („Come quick, danger“) 20 Minuten später noch einmal erkundigt habe, was geschehen sei. Der Mann habe offenbar seinen gesunden Menschenverstand nicht benutzt.
Weitere Kontaktversuche wiegelte der erste Funker Jack Phillips barsch ab, obwohl er wegen der Signalstärke vermutete, die „Frankfurt“ sei am dichtesten an der „Titanic“. Weil die „Frankfurt“ ihre Position laut Bride aber nicht mitgeteilt hatte, erschien Phillips jeglicher weitere Funkverkehr als vergeudete Zeit. Stattdessen konzentrierte er sich auf die Kommunikation mit der „Carpathia“, die dann als erstes Schiff an der Unglücksstelle eintreffen sollte – allerdings mehr als anderthalb Stunden nach dem Untergang der „Titanic“. Ein Überlebender heizte die Gerüchteküche an, die Weser-Zeitung druckte seinen Kommentar ab: „Taylor meint, wenn die ‚Frankfurt‘ sofort beigedreht hätte, würden wohl alle Passagiere gerettet worden sein.“
In Bremen reagierte man empört, den Vorwurf unterlassener Hilfeleistung wollte der Norddeutsche Lloyd nicht auf sich sitzen lassen. Man sah die nationale Ehre als gekränkt an, handele es sich doch um die „Schmähung eines deutschen Dampfers und damit der ganzen deutschen Schifffahrt“. Augenblicklich nahm man Kontakt zur „Frankfurt“ auf, parallel mühte sich der Vertreter des Lloyd in New York, Carl Elias von Helmolt, um Aufklärung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Die Anschuldigungen seien als „direkte Unwahrheiten“ zu kennzeichnen, lautete das Dementi aus dem Lloydgebäude (mehr dazu hier) in Bremen. Die „Frankfurt“ habe nach dem Hilferuf sofort Kurs auf die „Titanic“ genommen. Doch die Distanz von 140 Seemeilen habe das Schiff nicht rechtzeitig bewältigen können. „Als sie an der Unfallstelle eintraf, war die Katastrophe längst vorüber.“
Die „Frankfurt“ als Geisterschiff
Ganz anders klingt, was dazu noch immer in den Medien zu lesen ist. „Ob die ‚Frankfurt‘ hätte früher, noch rechtzeitig, da sein können? Niemand weiß es“, schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung zum 100. Jahrestag der Katastrophe im April 2012 unter der Überschrift „‚Frankfurt‘ nahe dran“. Bis in jüngste Zeit wurde sogar kolportiert, die „Frankfurt“ könnte das berüchtigte „Geisterschiff“ gewesen sein, dessen Lichter von der „Titanic“ gesichtet wurden. Eine der vielen Titanic-Legenden, wie die Titanic-Expertin Susanne Störmer meint. Als Beleg führt sie den weitgehend unbeachteten Bericht des dritten Offiziers der „Frankfurt“ an. Kurz nach dem Untergang schilderte Carl Herbert im Mai 1912 in einem langen Zeitschriftenbeitrag seine Sicht der Dinge. Es habe „kein Besinnen“ gegeben, schreibt er, zur Aufnahme Überlebender habe man umfangreiche Vorkehrungen getroffen.
Als die „Frankfurt“ nach zehnstündiger Fahrt um 10.50 Uhr am Ort des Geschehens eintraf, waren schon drei weitere Dampfer zugegen. „Nichts ist zu sehen, kein schwimmendes Wrackgut, keine Menschen, kein Boot“, schreibt Herbert. Nur Eisberge und lang gestreckte Eisfelder habe man ausmachen können. Auf knapp 60 Kilometer Länge schätzte er die Ausdehnung des Eisfelds. Bis zum Abend beteiligte sich die „Frankfurt“ an der Suche nach Überlebenden, dafür hielt das Schiff auf die größten Eisberge zu. „Wer weiß, ob dort nicht halberstarrte arme Überlebende der Rettung harren?“ Doch allmählich kehrte Ernüchterung ein. Herberts traurige Bilanz: Nur eine „Zigarrenkiste, einige Holzstücke und ein Deckstuhl treiben an uns vorbei“.

Hielt nicht viel vom Funkerkollegen auf der „Frankfurt“: der „Titanic“-Funker Harold Bride.
Quelle: Frei
Natürlich ist zu bedenken, dass Herberts Ausführungen Rechtfertigungscharakter haben. Als er seine Eindrücke zu Papier brachte, waren die Vorwürfe gegen die „Frankfurt“ noch immer Gegenstand von Nachforschungen. Diesmal im Rahmen der britischen Kommission, die vom 2. Mai bis 3. Juli 1912 in London zahlreiche Zeugen verhörte. Zuvor hatte die amerikanische Untersuchungskommission Bride in die Zange genommen. Bei der Vernehmung hakte der Leiter der Kommission, Senator William Alden Smith, wegen des sehr viel detaillierteren Austauschs der „Titanic“ mit der „Carpathia“ nach. Zur Begründung führte Bride die fehlende Positionsangabe der „Frankfurt“ an. Andernfalls hätte man die „Frankfurt“ ausführlich informiert und jedes Wort sicherheitshalber ein Dutzend Mal wiederholt.
In diesem Punkt weicht das Protokoll erheblich von den Angaben Herberts ab. Nach seiner Darstellung hatte die „Frankfurt“ ihre Position sehr wohl mitgeteilt und daraufhin von der „Titanic“ die Antwort erhalten: „Oh, Sie sind am nächsten. Bitte sagen Sie Ihrem Kapitän, dass er so schnell wie möglich uns zu Hilfe kommen soll, wir sind gerade mit einem Eisberg zusammengestoßen.“ Fast erleichtert erwähnt Herbert drei Rauchwolken am Horizont beim ersten Sichtkontakt zur Unglücksstelle, „dann waren wir also doch nicht die nächsten“. In dieser Angelegenheit steht Aussage gegen Aussage, endgültige Gewissheit dürfte kaum zu erlangen sein. Jedenfalls setzte die „Titanic“ aufs richtige Pferd – die „Carpathia“ war nur 107 Kilometer von der Unglücksstelle entfernt, die „Frankfurt“ 280 Kilometer.
Bleibt die Frage, wie die stärkeren Funksignale der „Frankfurt“ zu erklären sind. Bei seiner Aussage war sich der Betreiber der Funkstationen, Guglielmo Marconi, absolut sicher, dass auf beiden Schiffen seine Systeme im Einsatz waren. Ein Missverständnis zwischen den Funkern schloss er deshalb aus. Marconi hatte allen Grund zu seiner Annahme, damals gehörten ihm fast 90 Prozent aller Schiffsfunkstationen.
Doch im Fall der „Frankfurt“ lag er offenbar daneben. Nach Angabe des Museums für Kommunikation in Frankfurt war der gleichnamige Lloyd-Dampfer mit einem modernen Telefunken-Löschfunkensender ausgestattet. Im Vergleich zu den älteren Knallfunkensendern von Marconi seien sie viel leistungsstärker gewesen. „Den Ton der Löschfunkensender konnte man im Kopfhörer des Empfängers viel besser hören als das Knacken und Rauschen der Knallfunkensender.“ Was eine passende Erklärung für die stärkeren Funksignale der „Frankfurt“ wäre – und dem damit verbundenen Trugschluss, sie sei näher an der Unglücksstelle gewesen.
Nach dem Untergang der „Titanic“ verblieben den beiden Lloyd-Dampfern nur noch zwei Jahre bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Sowohl die „Bremen“ als auch die deutlich kleinere, nur mit einem Schornstein ausgestattete „Frankfurt“ verkehrten weiterhin im transatlantischen Liniendienst. Bei Kriegsbeginn im August 1914 befanden sich beide Schiffe in Bremerhaven. An eine Fortsetzung der Atlantikpassagen war schon vor dem Kriegseintritt der USA im April 1917 wegen der britischen Seeblockade nicht mehr zu denken.
Die „Frankfurt“ diente zunächst als Lazarettschiff, im Oktober 1917 beteiligte sie sich als Truppentransporter an der Landung deutscher Einheiten auf der damals russischen Ostseeinsel Ösel, heute die estnische Insel Saaremaa. Die „Bremen“ kam erst gegen Kriegsende als Truppentransporter zum Einsatz. Beide Schiffe mussten nach Abschluss des Versailler Vertrags 1919 als Reparationsleistung an Großbritannien abgegeben werden. Auf die Atlantikroute kehrte die „Bremen“ in den 1920er-Jahren als „Constantinople“ und „King Alexander“ zurück, die frühere „Frankfurt“ wurde ab 1923 als „Sarvistan“ in Indien und Ostasien eingesetzt. Mit nur kurzem zeitlichem Abstand wurde beide Schiffe 1929 und 1931 abgewrackt.
Die White Star Line dementierte anfangs den Untergang
Auf ihrer Jungfernfahrt kollidierte die „Titanic“ am 14. April 1912 um 23.40 Uhr auf dem Weg nach New York mit einem Eisberg. Zum Zeitpunkt des Unglücks befand sich der Stolz der White Star Line 300 Seemeilen südöstlich von Neufundland. Zwei Stunden und 40 Minuten später versank das Schiff im Nordatlantik, dabei kamen 1514 von 2200 Menschen an Bord ums Leben. Zunächst dementierte die Titanic-Reederei die Gerüchte vom Untergang, auch in der Weser-Zeitung hieß es, alle Passagiere hätten überlebt. In den kommenden Wochen beherrschte das Thema die internationalen Schlagzeilen, zwei Untersuchungsausschüsse in New York und London arbeiteten die Katastrophe auf.

Wenige Tage nach ihrer Abfahrt aus Southampton stieß die „Titanic“ im Nordatlantik mit einem Eisberg zusammen. Der Norddeutsche Lloyd sollte mehr damit zu tun haben, als ihm lieb sein konnte.
Quelle: Frei