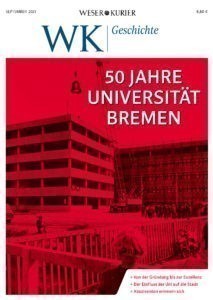Ein Bild aus glücklichen Tagen: das Ehepaar Margarethe und Karl Carstens sr. im Sommer 1911.
Quelle: Karl Carstens, Erinnerungen und Erfahrungen
Ein Bundespräsident aus Bremen: Karl Carstens
Bürgermeister Wilhelm Kaisen sah ihn als „Inkarnation der guten Errungenschaften des deutschen Bürgertums“. Und darum als potenziellen Nachfolger. Doch es kam anders. Statt Stadtoberhaupt wurde Karl Carstens Staatsoberhaupt. Sein Geburtshaus steht bis heute in der Fitgerstraße.
Gern hätte Bürgermeister Wilhelm Kaisen ihn als seinen Nachfolger gesehen. Freilich war das zu einer Zeit, als Karl Carstens noch nicht der CDU angehörte. Seinen Einwand, er sei kein SPD-Mitglied und wolle es auch nicht werden, wischte Kaisen resolut vom Tisch. „Für ihn war das nicht ausschlaggebend“, schreibt Carstens in seinen Erinnerungen. Doch Kaisens Wunsch ging nicht in Erfüllung. Nicht in seiner Heimatstadt machte der gebürtige Bremer Karriere. Sondern in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn. Statt Stadtoberhaupt wurde er schließlich Staatsoberhaupt – als fünfter Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland.
Im gutbürgerlichen Schwachhausen hat Carstens als Sohn eines Oberlehrers und einer Privatlehrerin das Licht der Welt erblickt. Sein Geburtshaus stand und steht noch immer in der Fitgerstraße. Die Nummer 36 ist bis heute ein stattliches Altbremer Haus. Doch man darf sich nicht täuschen über die Vermögensverhältnisse der Familie. Das Haus war kein Eigenheim. Das Ehepaar bewohnte nur eine Wohnung, nicht das gesamte Gebäude. Laut Adressbuch lebten die Carstens’ mit einem Baumwollklassierer unter einem Dach. Die elterliche Zweisamkeit schildert Carstens als Idylle. „Täglich machten meine Eltern Spaziergänge im nahe gelegenen Bürgerpark.“
Schon bei seiner Geburt ein Halbwaise

Eine gute Adresse in Schwachhausen: das Geburtshaus von Karl Carstens in der Fitgerstraße 36.
Foto: Frank Hethey
Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs machte die Familienidylle zunichte. Schon vor seinem Aufbruch an die Front sollen Vater Carstens düstere Todesahnungen geplagt haben. Der Sohn berichtet darüber in seinen Memoiren. Einer Nachbarin habe er erklärt, er werde nicht mehr zurückkehren und ihr aufgetragen, sich um Frau und Kind zu kümmern. Die tödliche Kugel traf ihn bei einer Patrouille am 6. Oktober 1914 bei Noyon in Nordfrankreich. Mithin war Carstens schon bei seiner Geburt am 14. Dezember 1914 ein Halbwaise, der Sohn einer „Kriegerwitwe“.
Den Verlust hat Carstens’ Mutter nie richtig verwunden. Zwar verlor sie nicht ihre Lebensenergie und zog den Sprössling hingebungsvoll auf. Sie bewahrte sich ihre resolute, bodenständige Art. Sich unterkriegen zu lassen kam nicht in Frage. 1926 verwirklichte sie sogar noch den lang gehegten Traum von den eigenen vier Wänden durch den Kauf eines Reihenhauses an der Busestraße – das bewerkstelligte sie, indem sie eine Etage vermietete und verstärkt Privatstunden gab.
Doch das alles änderte nichts an ihrer Gemütslage, bis zu ihrem Tod im Oktober 1963 trauerte sie um den geliebten Partner. Eine neuerliche Bindung kam für sie niemals in Betracht. „Als Witwe ist sie immer noch in Trauer um meinen Vater gestorben“, sagte Carstens einmal in einem Interview.
Bürgermeister Kaisen als Vaterfigur
Und der Sohn? Carstens beteuert, er habe seinen Vater als glühendes Vorbild gesehen. Doch das war eine naturgemäß abstrakte, eher pflichtschuldige Form der Verehrung. Es ist kaum zu übersehen, dass Carstens schon früh im Leben nach einem Ersatzvater suchte. Einer Vaterfigur, die ihm Orientierung geben konnte. Er fand sie in Bürgermeister Wilhelm Kaisen.

Der zwölfjährige Karl Carstens mit seiner Mutter im Jahre 1926.
Quelle: Karl Carstens, Erinnerungen und Erfahrungen
Seit ihrem ersten Kontakt 1948 verband die beiden gegenseitige Hochachtung. Carstens schätzte Kaisen als Realpolitiker, Kaisen sah in Carstens einen Geistesverwandten und darum potenziellen Nachfolger. Beide waren überzeugte Europäer, beide suchten den Kompromiss statt die Konfrontation. Beide hatten aber auch ihre Grundsätze: Carstens etwa in seiner starren Haltung in der Ostpolitik (mehr dazu hier). Zeitlebens tauschten sie Briefe aus. Augenzwinkernd schrieb Kaisen im März 1958, nun werde er ihn ja wohl bald als „Herr Ministerialdirektor“ ansprechen müssen. Und fügte lapidar hinzu: „Ein furchtbarer Titel, aber die Besoldungsordnung honoriert ihn gut.“ Umgekehrt war es Carstens vor allem in jüngeren Jahren immer wieder ein Bedürfnis, von seinen Erlebnissen und Erfahrungen zu berichten. Gleichwohl blieb eine gewisse Distanz, im persönlichen Umgang erhielt sich bis zuletzt das förmliche „Sie“.
Carstens war ein Spätberufener. Als ausgebildeter Jurist arbeitete er zunächst in seinem Traumberuf als Rechtsanwalt. Mit dem politischen Umfeld kam er erst durch einen Freund der Familie in Berührung, Senator Theodor Spitta. Der empfahl Carstens 1949 für den Posten des Bremer Landesbevollmächtigten in Bonn. Kaisen fand Gefallen an dem damals 35-Jährigen. Nach einiger Bedenkzeit schlug Carstens ein, jedoch ohne sich parteipolitisch zu binden. Auch nach seinem CDU-Eintritt 1955 verstand sich Carstens nicht in erster Linie als Parteimann.
Späte politische Karriere

Ab 1926 das neue Heim von Mutter und Sohn Carstens: ein Reihenhaus in der Busestraße.
Foto: Frank Hethey
Tatsächlich sollte es noch lange Jahre dauern, bis er in der CDU Karriere machte. Bis 1966 bekleidete er führende Positionen im Auswärtigen Amt, danach war er kurzzeitig Staatssekretär im Verteidigungsministerium und in der Spätphase der Großen Koalition 1968/69 Chef des Bundeskanzleramts. Mit dem Ausscheiden der CDU aus der Regierungsverantwortung war seine politische Laufbahn eigentlich beendet. Als Leiter eines Forschungsinstituts wandelte Carstens in den Folgejahren auf den ruhigen Bahnen der Wissenschaft. Erst als 57-Jähriger zog er 1972 in den Bundestag ein. Und das noch nicht einmal aus eigenem Antrieb. Durchaus glaubhaft versicherte er, sich gegen seine Nominierung als Bundestagskandidat gesträubt zu haben. „In diesem Alter fängt man keine neue berufliche Karriere an“, so Carstens über seine ablehnende Haltung.
Einmal gewählt, ging es dennoch rasch aufwärts. Als Rainer Barzel im Mai 1973 vom Fraktionsvorsitz nach einer internen Abstimmungsniederlage zurücktrat, rückte Carstens als Nachfolger ins Blickfeld. Freilich abermals ohne eigenes Zutun, widerstrebend beugte er sich der Parteiräson.
Als CDU-Fraktionschef hat Carstens nicht immer ein glückliches Händchen gehabt. Kritiker bemängelten, er habe sein Amt verwaltet wie ein höherer Beamter – der er ja auch lange Jahre gewesen ist. Die Konfrontation entsprach nicht seinem Wesen, widersprach auch seiner ausgleichenden, an Kaisen geschulten Art der politischen Auseinandersetzung. Sein Biograf Tim Szatkowski attestiert ihm deshalb einen „abwartenden Führungsstil“. Gemeint ist wohl Führungsschwäche.

So kennt man ihn: Karl Carstens nach seiner Wahl zum CDU-Fraktionsvorsitzenden im Mai 1973.
Quelle: Bundesarchiv Koblenz
Wegen NS-Vergangenheit in der Kritik
Repräsentative Posten wie der des Bundestagspräsidenten ab 1976 und dann des Bundespräsidenten ab 1979 dürften ihm mehr gelegen haben. Schwer getroffen hat ihn im Vorfeld seiner Wahl zum Staatsoberhaupt die Kritik an seiner NS-Vergangenheit, er fühlte sich als Opfer einer Hetzkampagne. Als Makel wollte Carstens seine Parteimitgliedschaft ab 1940 nicht begreifen, er verteidigte sich mit Hinweis auf kaum verhüllte Drohungen gegen sein berufliches Fortkommen. Allenfalls ein Mitläufer also, ganz gewiss kein Täter, kein Nazi aus Überzeugung. Dagegen spricht auch seine Sozialisation im bürgerlichen Milieu. Nicht umsonst attestierte ihm sein Mentor Kaisen, er verkörpere die „guten Errungenschaften des deutschen Bürgertums“.
Was ist von Carstens geblieben? Nicht viel, als Bundespräsident konnte er sich nicht profilieren, man kennt ihn höchstens noch als „Wanderpräsidenten“. Für eine zweite Amtszeit nach 1984 ist Carstens nicht mehr angetreten, schon bei seinem Tod am 30. Mai 1992 war er ein Vergessener. Der Fauxpas bei der Einweihung der Karl-Carstens-Brücke ist bezeichnend genug (mehr dazu hier). Als seine Witwe Veronica Carstens das Straßenschild enthüllte, stellte sich heraus, dass der Nachname des Geehrten irrtümlich mit „K“ geschrieben worden war.
Und keiner hatte es gemerkt.
von Frank Hethey