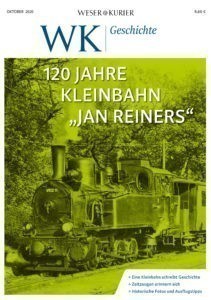Vor 75 Jahren übernahm Wilhelm Kaisen das Amt des Bürgermeisters – eine kritische Würdigung
Als Bremen nach Kriegsende in Trümmern lag, suchte der amerikanische Oberst Walter L. Dorn den früheren Senator Wilhelm Kaisen (SPD) auf. Dafür musste der Geheimdienstoffizier bis nach Borgfeld fahren, wo Kaisen seit 1933 eine kleine Siedlerstelle bewirtschaftete. „Ende April 1945 erschien er bei mir und traf mich auf einem Acker an, den ich für die Einsaat von Sommergetreide umgepflügt hatte“, schreibt Kaisen in seinen Erinnerungen, die 1967 unter dem Titel „Meine Arbeit, mein Leben“ erschienen. Über Dorns Besuch seien im Laufe der Zeit etliche Anekdoten in Umlauf gesetzt worden, so Kaisen weiter – und fügte gleich hinzu, sie stammten nicht von ihm. „Ich wurde dabei mit jenem Cincinnatus verglichen, den man vom Pfluge wegholte und zum römischen Konsul machte.“ Doch davon distanzierte sich Kaisen im gleichen Atemzug. „Die Wirklichkeit war nüchterner. Ich bat ihn ins Haus, und allmählich begann ein ernstes Gespräch über einen neuen Anfang für Bremen.“
Über den so ungemein populären Politiker, der vor genau 75 Jahren, am 1. August 1945, von der US-Militärregierung mit dem Amt des Bürgermeisters und Präsidenten des Senats betraut wurde, kursieren noch viele weitere Anekdoten. Sie zeichnen durchweg das Bild eines bodenständigen Norddeutschen, der nie sein Herkommen aus bescheidenen Verhältnissen vergaß. Der als Mann des Ausgleichs seinen geraden Weg ging, ohne sich jemals beirren zu lassen. Der sich auch für die Schmutzarbeit nicht zu schade war, als in Bremen der Trümmerschutt beseitigt werden musste. „Als erster packte er selbst zu – mit Schaufel und Spaten –, und hinter ihm die gesamte Bevölkerung ohne Unterschied des Standes und des Berufes“, schrieb Senatssprecher Alfred Faust am 16. Mai 1957 anlässlich von Kaisens 70. Geburtstag.

Der Bürgermeister beim Abklopfen von Trümmerschutt: eine Botschaft für die Öffentlichkeit.
Foto: Staatsarchiv Bremen
Am Image kräftig gefeilt
Zweifellos hat sich dadurch kein schiefes Bild über Kaisen im kollektiven Bewusstsein verankert. Kaisen kann tatsächlich als Charismatiker gelten, der Eindruck des prinzipientreuen Vollblutpolitikers ist sicher nicht falsch. Doch ein Sympathieträger wurde er nicht einfach nur durch seine bürgernahe Politik. Oder durch sein warmherziges, authentisches Auftreten. An dem so eingängigen Image des aufrechten Mannes haben fleißige Hände kräftig gefeilt: vor allem die Hände seines Pressechefs Faust.
Kaisens früherer Kollege bei der Bremer Volkszeitung hatte als Werbeleiter der Roselius-Firma Kaffee Hag einschlägige Erfahrungen gemacht, er wusste, wie man eine Marke etabliert. Faust versorgte die schreibende Zunft mit mancher Anekdote über Kaisen, bei der laut Hartmut Müller, Vorstandsmitglied der Wilhelm und Helene Kaisen-Stiftung, „Wahrheit und Dichtung oftmals nicht von einander zu trennen waren“. Der ehemalige Leiter des Staatsarchivs geht noch weiter: „So entstand eine ahistorische Heroisierung, eine Legende, fast ein Kaisen-Mythos.“
Die kritische Betrachtung ist wissenschaftliche Grundlagenarbeit. Schon Kaisen-Biograf Karl-Ludwig Sommer merkte vor 20 Jahren an, Kaisen habe sich keine Mühe gegeben, der Verklärung seiner Person entgegenzuwirken. Das dürfte nicht zuletzt für seine Inszenierung als zupackender Siedler gelten – immer wieder ließ sich Kaisen bei seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit ablichten. Ein Hang zur Selbstmystifizierung ist auch in seinen Erinnerungen spürbar. Als Indiz kann der legendäre Besuch Dorns gelten: Führt Kaisen erst noch ins Feld, er habe den Amerikaner zum Gespräch ins Haus gebeten, schreibt er an anderer Stelle, bereits „auf meinem Acker“ habe er Dorn auseinandergesetzt, dass für Sieger wie Besiegte das Völkerrecht gelte.
In den jüngsten Veröffentlichungen zu Kaisen wird denn auch angemahnt, seine Erinnerungen mit gebotener Vorsicht zu lesen. „Wo es auf historische Fakten und exakte Daten ankommt, sind diese nicht immer zuverlässig“, so Müller. Ein besonders haarsträubender Fehler hat sich beim Datum seiner Amtseinführung als Bürgermeister eingeschlichen: Kaisen terminiert den Akt auf den 17. Juni 1945, obwohl er erst knapp anderthalb Monate später vonstatten ging.
Sachlich nicht zu halten sind auch einige Angaben zum persönlichen Schicksal im Dritten Reich. Anders als Kaisen andeutet, war er im Frühjahr 1933 keineswegs rund zwei Monate inhaftiert, sondern nur acht Tage. Die Haftbedingungen waren zudem weit entfernt von den Zuständen in den berüchtigten Folterkellern der SA. Wie Müller in seinem Beitrag „Schicksalsjahr 1933. Wilhelm Kaisen: Mythos und Wirklichkeit“ darlegt, wurde Kaisen nicht malträtiert, es drohte offenbar auch nichts dergleichen. Doch in seinen Erinnerungen erweckt Kaisen einen anderen Eindruck.

Der Mann aus Borgfeld: Wilhelm Kaisen als zupackender Siedler.
Foto: Archiv des WESER-KURIER
Das letzte Wort zu Kaisen ist also noch längst nicht gesprochen. Dabei rückt sein Verhältnis zum Dritten Reich zusehends ins Blickfeld. Seine Gegnerschaft zur „nationalen Revolution“ der Hitler-Partei ist zwar evident, als führender Sozialdemokrat und Mitglied des Senats hatte er nach der NS-Machtübernahme keine politische Zukunft mehr. Mit seinem Rücktritt als Wohlfahrtssenator am 6. März 1933 zog er die Konsequenz aus den neuen Verhältnissen. Sein Umzug vom Eigenheim in Findorff auf die Siedlerstelle in Borgfeld im Dezember 1933 markiert seinen Abschied aus Bremen, seine erzwungene Abkehr von der aktiven Politik.
Umso mehr irritiert es, dass sich Kaisen 1952 für die Begnadigung des früheren Bremer Gestapo-Chefs Erwin Schulz einsetzte. Schulz war als Kriegsverbrecher in Landsberg inhaftiert. Hans Wrobel hat sich ausführlich mit dem Thema befasst, ohne letzte Klarheit darüber zu erlangen. In die gleiche Kategorie fällt Kaisens Einsatz für deutsche Kriegsverbrecher, die in Frankreich einsaßen. Eine mögliche Erklärung hat Kaisen-Expertin Eva Determann parat: „Dahinter dürfte sein Grundgedanke stecken, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient.“
Politisches Comeback
Ebenso kann man sich den Kopf darüber zerbrechen, ob sein politisches Comeback ein Selbstgänger war. „Ich glaube, Kaisen konnte nicht anders“, sagt Müller. „Er war durch und durch politisch, seine ganze Biografie ist politisch ausgerichtet gewesen.“ Sich vor der Verantwortung zu drücken, kam für den 58-Jährigen augenscheinlich nicht in Betracht. Da spielte es auch keine Rolle, dass er Gefallen gefunden hatte an seinem Siedlerdasein.
Als ihm der Bürgermeisterposten angeboten wurde, war Kaisen sofort wieder in seinem Element. Er stellte Bedingungen: Die ungeliebte, erst von den Nazis eingeführte Amtsbezeichnung des „Regierenden Bürgermeisters“ wollte er loswerden. Allerdings keineswegs, um unverzüglich vom Führerprinzip zum Kollegialprinzip zurückzukehren. Im Gespräch mit Militärgouverneur Bion C. Welker verlangte Kaisen, dass „in der Stellung, wie sie der Regierende Bürgermeister Vagts inne hatte, nichts geändert werden solle“.
Aus heutiger Sicht auch erstaunlich, dass ein Mann, der doch so viel Wert darauf legte, die politischen und gesellschaftlichen Kräfte zu bündeln, so wenig anfangen konnte mit der Gleichberechtigung der Frau. Seine Senatorenriege präsentiert sich als fast lupenreine Männerdomäne. Eigentlich merkwürdig, hatte er doch mit Helene Kaisen eine hochpolitische Frau an seiner Seite. Dass sie für ihn eine wichtige politische Ratgeberin war, steht außer Frage. Man kann noch nicht einmal sagen, dass nur ihr Rat für ihn zählte, er aber sonst nichts gegeben hätte auf die politischen Ansichten von Frauen. Die sozialistische Denkerin Rosa Luxemburg, deren persönliche Bekanntschaft er vor dem Ersten Weltkrieg auf der Parteischule der SPD in Berlin gemacht hatte, war für Kaisen ein Vorbild. „Er hat Rosa Luxemburg sehr verehrt“, sagt Determann, „er wollte immer noch eine Biografie über sie schreiben.“
Wie sich einen Reim darauf machen? Die Antwort dürfte so banal wie einleuchtend sein: Ganz offenbar war er noch einem eher patriarchalischen Denken verhaftet, darin unterschied er sich nicht vom gesellschaftlichen Konsens. „Er war eben auch ein Kind seiner Zeit“, sagt Determann.
Das Phänomen Kaisen bleibt ein dankbarer Forschungsgegenstand. Dem trägt die Kaisen-Stiftung jetzt Rechnung, indem sie die längst vergriffene Kaisen-Biografie von Karl-Ludwig Sommer neu auflegt – vielleicht ja auch in überarbeiteter Form.

Ein Homo Politicus: Wilhelm Kaisen – hier im Dezember 1945 – ließ sich nicht lange bitten, als nach Kriegsende seine Mitarbeit gefragt war.
Foto: Karl Edmund Schmidt