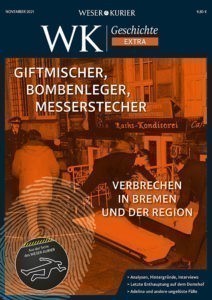Noch immer Sonderzulagen: Lebensmittelkarte
für Mittelschwerarbeiter vom Dezember 1949.
Quelle: Sammlung Peter Strotmann
Ein spezielles Kapitel der frühen Nachkriegsjahre: Fischverkauf an der Schlachte
Mit dieser und ähnlichen Anzeigen warben die Fischverkäufer ab 1949 in den Bremer Tageszeitungen: „Morgen lebendfrische Schollen, Seezungen und Steinbutt, große und kleine lebende Weseraale. Billig! Billig! Am Anleger Martinistraße, Weserbrücke“, hieß es im Weser-Kurier.
Da kamen den „alten Bremerinnen“ sicher Erinnerungen an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Auch damals steuerten die Fischkutter von der Unterweser die Schlachte in Bremen an. Diese Tradition wurde durch den Zweiten Weltkrieg jäh unterbrochen.
Im Krieg und danach folgte die jahrelange Bewirtschaftung von Lebensmitteln durch „Lebensmittelkarten“. Damit wurde eine minimale Ernährung der Bevölkerung weitgehend sichergestellt.
Gegen Ende der 1940er Jahre gab es jedoch immer mehr Waren, die frei verkäuflich waren. Dazu gehörte auch Fisch. Jetzt brauchten die Fischer aus Nordenham, Brake und Hammelwarden ihre Fänge nicht mehr zu niedrigen Preisen an die Genossenschaften abzugeben. Durch freien Verkauf erhofften sie sich höhere Erlöse.

Billig, billig: Mit solchenAnzeigen warben die Fischer für ihre Ware.
Quelle: Anzeige im Weser-Kurier vom 25. Juli 1950
Am 20. Juli 1949 fand der erste Verkauf am Martinianleger statt. Wenn die Fischer ihr Kommen in einer Anzeige angekündigt hatten, strömten überwiegend Hausfrauen an die Weser, um billig an frischen Fisch zu kommen. Mit Eis wurden die Fische frischgehalten. Der Fisch selbst wurde in Pergamentpapier eingeschlagen, als Einwickelpapier diente eine alte Tageszeitung. Ende der 1950er wurde der Fischverkauf am Martinianleger eingestellt.
Die Fisch-Lucie, ein Bremer Original
Wer in Bremen von Fischfang und Fischverkauf erzählt, landet zwangsläufig bei einem bekannten Bremer Original: der Fisch-Lucie, einer ganz besonderen Frau. Eigentlich hieß sie Johanna Lucie Henriette Flechtmann, geborene Hartig, verwitwete Lorenz. Sie lebte von 1850 bis 1921. Der erste Ehemann Lorenz starb nach kurzer Ehe und von Flechtmann, dem zweiten Ehemann, trennte sie sich 1890.
Nach zwei Ehen hatte sie 17 Kinder zu versorgen. Aber sie biss sich als Fischverkäuferin durch. Ihren Stand hatte sie vor der Börse (heute: Haus der Bremischen Bürgerschaft). Sie war eine geschäftstüchtige und ehrliche Frau. Wenn sie meinte, Recht zu haben und mit ihrer Schlagfertigkeit nicht weiterkam, dann griff sie schon mal zu einem Fisch und setzte ihn als Waffe ein.
Im kaufmännischen Sinne waren ihre frühmorgendlichen Einkaufszüge besonders gefürchtet. Mit einem eigenen Boot fuhr sie des Morgens den heimkehrenden Fischern auf der Weser entgegen und kaufte denen ihre Ware ab. Sie wollte immer den frischesten Fisch haben. Und den hatte sie und hielt damit ihren guten Ruf.

Fischer an Bord seines Schiffes beim Verkauf von frischem Fisch am Martinianleger im Jahre 1953.
Quelle: Staatsarchiv Bremen
Und der Fisch lag ihr „im Blut“, denn sie entstammte einer Fischhändlerfamilie, die nachweislich mehr als 200 Jahre im Fischhandel tätig war. Nach ihrem Tode führten zwei Söhne den Fischhandel in Woltmershausen bis 1988 fort. Die Tochter Lucie Götz, geborene Flechtmann, betrieb eine Fischhandlung in der Neustadt, Hermannstraße 101. Sie war wie ihre Mutter sehr schlagfertig und resolut und starb 1950.
Peter und die Aale
Es mag so im Jahre 1956 gewesen sein. Da gab mir meine Mutter den Auftrag, Fisch vom Martinianleger zu holen. „Drei Pfund Kochfisch, drei Pfund grüne Heringe und drei kleine Aale“, so lautete mein Auftrag. Das alles sollte fünf Mark kosten.
Gesagt getan.
Mit einem Einkaufsnetz kam ich nach Hause zurück. Freitags war bei uns Fischtag und so kam der Kochfisch bald in einen Kochtopf. Die grünen Heringe mussten noch ausgenommen werden, wurden gebraten und in Essig eingelegt.
Nur die Aale blieben noch über.
Als sie aus dem Papier ausgepackt wurden, lagen sie wie tot da. Die Aale haben eine Schleimschicht und gleiten, wenn sie noch leben, aus der Hand. Um sie fassen zu können, waren sie von der Fischern mit Sägemehl bestreut und feucht gehalten.

Fisch-Lucie auf dem Bremer Wochenmarkt im Jahre 1912, im Gespräch mit einem Dienstmädchen
Quelle: Staatsarchiv Bremen
Nichts Böses ahnend, wusch ich sie in der Spüle unter Wasser ab. Doch plötzlich wurde diese Viecher lebendig und zappelten wild herum. „Lass schnell Wasser in die Badewanne und hinein damit“, rief meine Mutter.
Und schon hatten wir neue Haustiere.
Die drei knapp vierzig Zentimeter langen Aale schwammen ruhig ihre Bahnen. Sie hatten von Hautatmung wieder auf Kiemenatmung umgeschaltet. Und wir hatten ein Problem.
Meine Mutter schaute ins dicke Kochbuch und las: „Aale tötet man sehr leicht, rasch und einfach, indem man sie in ein tiefes, großes Gefäß legt, in das man vorher ½ Liter Weinessig und 250 Gram Kochsalz getan hat; darnach kommen die Aale hinein, man deckt das Gefäß zu und bedeckt denselben. Nach einigen Minuten kann man die Aale, die nun ganz blau geworden sind, tot herausholen.“
Das schien meiner Mutter doch recht aufwendig zu sein. Als mein Vater nach Hause kam, wusste der erst auch keinen Rat. Doch er ging zu einem Nachbarn in der Straße. Der war Angler und sagte: „Aale bekommen keinen Betäubungsschlag. Um den Aal greifen zu können, muss man sich vorher die Hände mit Salz einreiben. Dann durchtrennt man die Wirbelsäule mit einen scharfen Messer. Danach ist der Aal sofort auszunehmen. Das Herz und Galle müssen entfernt werden. Die Galle darf nicht beschädigt werden. Der Fisch muss ordentlich ausbluten. Anschließend schneidet man die Haut am Hals ringförmig ein, löst die Haut vom Fleisch und schneidet die Flossen ab. Nun zieht man die Haut in einem Zug bis zum Schwanz ab. Ordentlich waschen, in Mehl wälzen und dann in Schmalz braten.“
Mein Vater berichtete uns alles und verschwand im Wohnzimmer. Meine Mutter und ich machten uns dann gemeinsam an die Arbeit und schafften es. Das war auch das erste und letzte Mal, dass es lebende Aale im Hause Strotmann gegeben hat.
von Peter Strotmann

Das waren noch Zeiten: Fischverkauf am Martinianleger direkt ab Kutter im Jahre 1953.
Quelle: Staatsarchiv Bremen