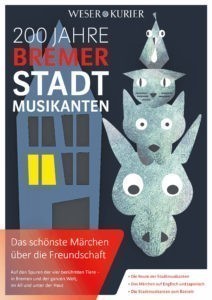Vor 50 Jahren
Auf dem Bremer „Drogenmarkt“ herrscht Unruhe. Und das mit Grund. Der Zollfahndung fiel gestern früh an der Getreideverkehrsanlage die größte bisher in der Hansestadt beschlagnahmte Menge Haschisch – 89,25 Kilo im Werte von rund 450 000 Mark – in die Hände. Ein 31 Jahre alter Decksmann hatte das Rauschgift vermutlich gemeinsam mit zwei anderen Besatzungsmitgliedern von Bord des Bremer Frachters „Seeteufel“ (1342 BRT) ins Wasser geworfen. Als ein Stauer der Bremer Lagerhaus-Gesellschaft kurz darauf am Achterdeck des Schiffes, zwischen Bordwand und Pier, einen Koffer schwimmen sah, alarmierte er Kollegen, die dieses Gepäckstück, einen weiteren Koffer und einen Seesack aus dem Hafenbecken fischten. In allen dreien befand sich „heiße“ Ware: Haschisch! (WESEER-KURIER, 26./27. Februar 1972)
Hintergrund
Nach dem Fund im Hafenbecken durchsuchten Zollbeamte und Beamte des Drogendezernats der Kriminalpolizei die „Seeteufel“. An dem Tag gelang dem Zoll und der Kripo nicht nur der bis dato größte Drogenfund, es fand sich auch noch ein weiteres wichtiges Beweisstück: In der Kajüte des Decksmannes entdeckten die Ermittler eine Liste mit Adressen in Bremen lebender Personen, die mutmaßlich einem „Rauschgiftverteilerkreis“ angehörten. „Vielleicht gelingt es uns jetzt, an den Verteilerkreis heranzukommen und den Handel zu sprengen!“, sagten damals die leitenden Beamten. Die Adressen deuteten demnach einwandfrei darauf hin, dass das Rauschgift für den bremischen Markt bestimmt war.
„Bremen liegt heute nicht mehr unbedingt auf den Schmuggelrouten. Hier wird zwar auch immer mal wieder etwas gefunden, aber das meiste läuft über Bremerhaven“, erklärt Zollsprecher Volker von Maurich. Die größten Kokainfunde der vergangenen Jahre waren 1,1 Tonnen und 1,4 Tonnen, die 2017 und 2020 in Bremerhaven sichergestellt wurden.
Die Suche nach Drogen in einem Hafen, in dem jährlich etwa fünf Millionen Container umgeschlagen werden, gleicht einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen. „Wir führen eine Risikoanalyse durch und schauen auf die Herkunftsländer der Container“, erläutert von Maurich. Besonders Container aus Mittel- und Südamerika würden oft genauer unter die Lupe genommen. Mehr Details nennt von Maurich nicht. Schmuggler nutzten heute oft die sogenannte Rip-off-Methode, um ihre Drogen zu transportieren. „Tätergruppen haben Zugriff auf den Container in Südamerika. Oft finden sie ihn mithilfe von GPS-Technik“, sagt der Zollsprecher. Sie öffneten die Container und deponierten die Drogen nahe der Tür, wo sie im Ankunftshafen von den Abnehmern schnell gefunden werden können.

Genau 89,25 Kilo Haschisch und der Schmuggler gingen dem Bremer Zoll und der Kriminalpolizei Ende Februar 1972 ins Netz.
Foto: Walter Schumann