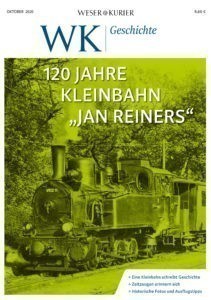Zum Weltfrauentag: Antisemtische Tendenzen bei der niederdeutschen Schriftstellerin
Als niederdeutsche Schriftstellerin steht Alma Rogge bis heute in hohem Ansehen. In Bremen-Nord ist eine Straße nach ihr benannt, vor ihrem ehemaligen Wohnhaus direkt am Weserufer in Rönnebeck hält ein Gedenkstein die Erinnerung an sie wach. Ihre Volkstümlichkeit ist legendär, sie gilt als Frau mit dem Herzen auf dem richtigen Fleck. Als eine, die sich nicht verbiegen ließ, die kein Blatt vor den Mund nahm. Schon gar nicht als Chefredakteurin der renommierten Heimatzeitschrift „Niedersachsen“, die sie offiziell erst seit 1931 leitete, inoffiziell aber schon seit 1926. Ohne Rücksicht auf irgendwelche Befindlichkeiten mischte sie schon damals die männerdominierte Heimatbewegung kräftig auf, die vielerorts anzutreffende betuliche Heimattümelei war ihr ein Dorn im Auge. Eine beeindruckende, eine emanzipierte Frau, die vor keiner Kontroverse zurückschreckte.
An sich also eine Persönlichkeit, die wie geschaffen scheint für eine Würdigung anlässlich des Weltfrauentags am kommenden Dienstag. Zumal ein breiter Konsens darüber besteht, dass sich Alma Rogge im wohltuenden Gegensatz zu vielen Weggefährten aus der Heimatbewegung politisch nichts vorzuwerfen habe. Der Boykott jüdischer Geschäfte im April 1933 fand nicht ihren Beifall und ihrem jüdischen Lektor in Berlin hielt sie sogar noch die Treue, als der schon längst keine berufliche Zukunft mehr hatte. Anders als ihr väterlicher Freund August Hinrichs ist sie auch niemals der NSDAP beigetreten. „Nein, Deine kluge Landestochter hat sich aus allem rausgehalten“, schrieb sie ihm im November 1946 in Anspielung auf dessen frühere Position als Landesleiter der Reichsschrifttumskammer für das Gau Weser-Ems. Entsprechend lautet ihre Angabe im Entnazifizierungsbogen: „Meine ganze schriftstellerische Arbeit war rein schöngeistig oder heimatkundlich und niemals politisch, noch tendenziös oder propagandistisch.“
Distanz zur NSDAP nur die halbe Wahrheit
Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Zu denken gibt schon allein ein Brief, mit dem Hinrichs ihr im März 1930 ins Gewissen redete, als sie gegen den jüdischen Theaterkritiker Erich Schiff polterte. „Es ist kein Grund, eine Kritik abzulehnen, weil der Verfasser Jude ist, kein sachlicher Grund, meine ich, und es ist vornehmer, nur rein sachlich zu bleiben.“ Bemerkenswerte Worte aus der Feder eines Mannes, dessen Ehrenbürgerwürde die Stadt Oldenburg wegen allzu großer Nähe zum NS-Regime erst im vergangenen Herbst einkassiert hat.
Wie lässt sich das deuten? Wirklich nur als biografisch bedingte Vorprägung der Bauerntochter, als Ausfluss einer „allgemein auf dem Lande verbreitete(n) Aversion gegen den Juden als Viehhändler und Geldverleiher“, wie es 1994 in der Zeitschrift „Quickborn“ hieß? Damit macht man es sich wohl doch etwas zu einfach. Genauso wie die Parteimitgliedschaft nicht automatisch als Beweis für antisemitische Gesinnung herhalten kann, darf fehlende Parteizugehörigkeit nicht voreilig als „Persilschein“ für gesellschaftspolitische Unbedenklichkeit gewertet werden. Man konnte Rassist sein auch ohne Hitler zu huldigen. Man konnte sogar Mitgefühl für einzelne Juden empfinden und sie als Kollektiv dennoch verdammen. Ein Widerspruch ist das nicht.
So zu tun, als seien ihre kompromittierenden Äußerungen nur Ausdruck eines unreflektierten „Bauchgefühls“ gewesen, geht am Kern der Sache vorbei. Alma Rogge war viel zu klug, um sich einfach nur von Emotionen treiben zu lassen. Als denkender Mensch hatte sie das Bedürfnis, relevante Fragen intellektuell zu durchdringen. Das galt auch und gerade für die „Judenfrage“ als Topthema ihrer Zeit. Dass sie schon in jungen Jahren nicht frei war von antisemitischen Anwandlungen, zeigen Fundstücke aus ihrem Nachlass im Bestand der Landesbibliothek Oldenburg. „In geistiger Hinsicht haben uns die Juden schon besiegt“, notierte die damals 25-Jährige im August 1919 in ihrem Tagebuch. „Jesus war Jude u. seine Religion ist Demokratie. Jetzt brauchen sie nur noch die politische Herrschaft zu erringen – u. wie weit sind sie darin schon gekommen.“
Eine echte Integrationschance sprach Alma Rogge den Juden rundheraus ab
Nichts weiter als ein Reflex auf die schwierigen Verhältnisse unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkriegs? Keineswegs, wie ein Blick in ihre nachgelassenen Schriften ergibt. Noch in einem unveröffentlichten Manuskript aus den Jahren um 1960 zieht sie gegen die „jüdische Rasse“ vom Leder. Eine echte Integrationschance spricht sie den Juden rundheraus ab. Auch wenn sie schon seit Generationen im Lande wohnten, „so wirken doch von der Überlieferung, vom Glauben und von ererbten, unbewussten Wesenheiten her die Grundlagen einer anderen Rasse in ihnen weiter“.
Die Weltgeschichte als permanenter Rassenkampf: hier die „Gastvölker“, dort die Juden als Eindringlinge, als bewusste oder unbewusste Vorkämpfer ihrer Rasse. Alma Rogge: „Darum hat es in allen Jahrhunderten und bei allen Völkern Judenverfolgungen gegeben: eine anders geartete und in ihrem Wesen tiefer verbundene Völkergemeinschaft stößt sie aus.“ Da klingt es schon ziemlich heuchlerisch, wenn sie kundtut: „Die Tragödie des Judentums ist die leidvolle Tragödie der Heimatlosigkeit.“ Den Holocaust billigt sie zwar nicht. Vielmehr spricht sie von Spannungen, die sich „eines Tages in unheilvoller Weise entladen“. Gleichwohl hält sie „Rassenfeindschaft“ für begreiflich, nur „im höheren Grad“ geschehe dadurch „schweres Unrecht“.
Fürwahr harter Tobak. Auch in ihren publizistischen Beiträgen für die Zeitschrift „Niedersachsen“ jonglierte sie ganz selbstverständlich mit dem damals durchaus gängigen Rassebegriff. „Die Flamen gehören wie wir der germanischen Rasse an“, dozierte sie im Mai 1927. Alma Rogge war also ganz gewiss kein Mensch, der keinerlei Berührungspunkte mit der NS-Ideologie gehabt hätte. Wohl beklagte sie in der Nachkriegszeit in kulturpessimistischer Manier einen kontinuierlichen Werteverfall „in den letzten beiden unseligsten Jahrzehnten deutscher Geschichte“. Doch als Gegenmittel fiel ihr nichts anderes ein, als „unsere arteigene Wesensprägung“ zu stärken und zu bewahren.
von Frank Hethey
Erschienen im Kurier am Sonntag, 6. März 2016