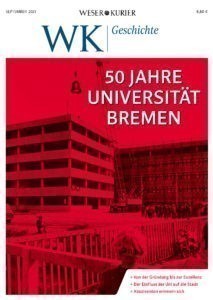Kein Durchblick: 1972 wurde ein Werderspiel gegen Gladbach wegen Nebel abgesagt
Am 31. Oktober 1972 – mein erster Freimarktbesuch lag gerade hinter mir – radelte ich über die Weser zum Weserstadion. Ich hatte nur ein Ziel: Günter Netzer zu sehen. Um ehrlich zu sein, die inzwischen legendären Namen Bonhof, Vogts und Heynckes sagten mir damals überhaupt nichts (geschweige denn Wimmer, Danner und Rupp). Es war der 10. Spieltag meiner ersten Werder-Saison, meines ersten Jahres in Bremen. Mittwochabend, Anstoß 20 Uhr, Bremer Schmuddelwetter. Damals wusste ich noch nicht, dass das eigentlich die optimalen Voraussetzungen für einen Bremer Sieg hätten sein können. Aber …
Schon auf der Großen Weserbrücke merkte ich, dass es ungewöhnlich nebelig war. Oben auf dem Radweg am Osterdeich konnte ich den Fluss kaum sehen, und ich hatte den Verdacht, dass es noch schlimmer kommen könnte. Als ich mein Fahrrad am Treppengeländer anschloss, sah ich, dass das Stadion von einer gelblichen Schwefelsuppe umspült war, aber das Flutlicht suggerierte noch Licht, gute Sicht und Zuversicht.

Ian Watson: Spielfelder – eine Fußballmigration
184 S., 22 Abbildungen
Edition Falkenberg: Bremen 2016
14,90 Euro
ISBN 978-3-95494-097-4
In der Ostkurve, wo ich dann zwischen lauter Fremden stand, war das Licht bereits stumpfer und noch mehr ockerfarben. Um mich herum kamen erste Zweifel auf. Aber, seht doch, die Mannschaften laufen sich schon warm, ein gutes Zeichen. Und unsere laufen direkt vor uns! (Eigentlich waren sie für mich noch nicht „unsere“, sondern nur „Werder Bremen“.)
Borussen im Nebel
Dann tauchten die Borussen aus dem Nebel auf. Mitten drin, über einem babyblauen Trainingsanzug, leuchteten die blonden Haare des Märchenprinzen. Er joggte in unser Gesichtsfeld und wieder heraus, rein und raus, rein und raus. Aber jedes Mal, wenn wir ihn erneut sahen, hatte er weniger Profil, mal schien er verschwommen, mal geisterhaft gruselig, passend zum Datum: Halloween. Manchmal sah man den Trainingsanzug gar nicht mehr, sondern nur noch die Haare.
Langsam verwandelte sich das Spielfeld in eine Waschküche, allerdings in eine sehr kalte. Im Flutlicht und Nebel mischten sich Ocker und Grün, und ich musste an den englischen Ausdruck für einen solch dicken Nebel denken: a pea-souper – Erbsensuppe. Von der Ostkurve aus konnten wir nur zwei Eckfahnen sehen. Ich meinte, die Regel aus England zu kennen, dass der Schiedsrichter vom Mittelpunkt aus alle vier Eckfahnen sehen können müsse, und sagte das dem Mann. Nein, klärte er mich auf, die Regel, jedenfalls in Deutschland, laute: „Sicht von Tor zu Tor muss gegeben sein.“
Längst waren der Schiedsrichter, die Linienrichter und Vereinsoffizielle auf dem Platz. Unsere Hoffnung verdampfte in den Nebel hinein wie Schweiß, kroch aus Ärmeln und aus der Lücke zwischen Hals und Kapuze. Wir traten von einem Fuß auf den anderen, das Gemurmel wurde lauter. Beruhigende Durchsagen wurden gemacht, um uns still zu halten: Schiedsrichterteam … entscheiden … beide Spielführer … noch warten … Dann verschwanden beide Mannschaften, die Offiziellen und das Schiedsrichterteam vom Platz. Was als Nächstes kam, war inzwischen nur allzu klar: Spielabsage. Auf meinen Märchenprinzen musste ich also noch weiter warten. Später einmal sah ich ihn dann doch leibhaftig, „in Echt“, bevor er gen Madrid verschwand.
Ich war so enttäuscht und viel zu müde, um direkt über die Brücke in die Neustadt zurück zu radeln. Erst musste ein Bier her. Und so wurde das der Abend, an dem ich an der Ecke Hemelinger- und Hildesheimer Straße die Brommy Kneipe entdeckte, diese Werder-Kultstätte, die inzwischen auch für meine erwachsenen Kinder nach jedem Heimspiel Pflicht ist. Und so endete der Abend für mich dann doch noch mit einem kleinen Sieg und einem kleinen Schritt vorwärts auf dem Weg, ein echter Bremer zu werden.
von Ian Watson
Abdruck aus Ian Watson, Spielfelder: eine Fußballmigration. Edition Falkenberg | ISBN 978-3-95494-097-4 | lieferbar ab 2. Juni 2016