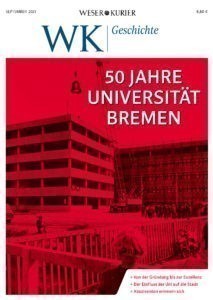So etwas hatte Bremen noch nicht erlebt: Bei den „Straßenbahnunruhen“ im Januar 1968 lieferten sich meist jugendliche Demonstranten stundenlange Straßenschlachten mit der Polizei, in Bremens „guter Stube“ fuhren Wasserwerfer auf, prügelnde Polizisten sorgten für Schlagzeilen. Nicht Westberlin als Zentrum der Studentenrevolte machte im rebellischen Jahr 1968 den Anfang, sondern das beschauliche Bremen. „Wieso gerade dort, wo die Linke regiert, ein jugendlicher Sturm losbrach, der nicht von rechts kam, scheint rätselhaft“, grübelte „Der Spiegel“ am 29. Januar 1968. Halb schockiert, halb amüsiert nahm Deutschland die ausufernden Proteste gegen die drastischen Fahrpreiserhöhungen zur Kenntnis – Bremen als Epizentrum des aufmüpfigen Zeitgeistes.
Völlig außen vor war dabei ausgerechnet der Mann, der kurz zuvor im November 1967 den Studentenführer Rudi Dutschke in die „Lila Eule“ gelotst hatte: der damals noch in der SPD beheimatete Olaf Dinné, später Mitbegründer der Bremer Grünen Liste. Im Grunde kein Wunder, gehörte der 32-Jährige doch einer ganz anderen Generation an als die jugendlichen Querköpfe. Zwar traf sich der Polit-Nachwuchs in seinem Musikkeller, doch Dinné winkte nur müde lächelnd ab, als er von den Aktionsplänen hörte.
Mit einiger Sicherheit befeuerte die Spaltung der Bremer Schülerbewegung den Gang der Ereignisse. Kurz vor der Dutschke-Visite hatte sich ein städtischer Ableger des zuerst in Bremen-Nord aktiven Unabhängigen Schülerbundes (USB) als linkes Gegenstück zum etablierten Arbeitskreis Bremer Schülerringe (ABS) gegründet. Im Vorfeld der Tariferhöhung hatte der ABS das Heft in der Hand, doch die Initiative zur Blockade der Straßenbahnschienen dürfte vom USB ausgegangen sein – wohl auch, um der Konkurrenz eins auszuwischen. „Wir wollten mehr tun, als nur ein Flugblatt zu verteilen“, sagt der damalige USB-Aktivist Joachim Barloschky.
Schüler blockieren Schienen
So kam es denn auch. Eher zögerlich ließen sich die Schüler am 15. Januar 1968 auf den Gleisen nieder – ohne zu ahnen, was sie damit lostraten. Schon bald flogen die ersten Steine, es kam zu Sachbeschädigungen, der Verkehr in der Innenstadt brach zusammen. Beharrlich versuchten die Behörden, über gemäßigte Schülervertreter auf die Demonstranten einzuwirken. Doch schon am zweiten Tag war nichts mehr zu machen. Gar nicht einmal so sehr, weil irgendwelche „Rädelsführer“ die Stimmung angeheizt hätten. Sondern weil das Geschehen innerhalb kürzester Zeit eine Eigendynamik entfaltete, die sich nicht mehr kontrollieren ließ. „Niemand konnte was tun, um das Ganze einzuschränken oder zu organisieren“, erinnert sich Christoph Köhler, später Soziologieprofessor an der Universität Jena.
In dieser Situation fiel der ratlosen Staatsmacht nichts anderes ein, als mit eiserner Hand für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Zwei Tage lang spielten sich in Bremens „guter Stube“ bis dahin unbekannte Szenen ab, prügelnde Ordnungshüter machten Jagd auf Demonstranten. Noch lebhaft kann sich Barloschky an die „Knüppelgarden“ erinnern. Allein am dritten Protesttag meldete die Polizei knapp 100 vorläufige Festnahmen, unter ihnen der heutige Grünen-Politiker Robert Bücking. Harmlose Passanten gerieten ins Visier der Wasserwerfer, in einem ununterbrochenen Katz-und-Maus-Spiel maßen Demonstranten und Polizisten ihre Kräfte.
Zu trauriger Berühmtheit gelangte der sozialdemokratische Polizeipräsident Erich von Bock und Polach mit seinem denkwürdigen Hetzruf „Draufhauen, draufhauen, nachsetzen!“ Wenig erstaunlich, dass der frühere SS-Standartenführer zum bevorzugten Hassobjekt der Demonstranten avancierte. „Macht den Bock zum Gärtner!“, war auf einem der Protestplakate zu lesen. Viele Bremer reagierten schockiert auf die Gewalt inmitten der Stadt. Die verbreitete Meinung laut Barloschky: „So etwas darf man mit unserer Jugend doch nicht machen.“ Seit Kriegsende sei es der „brutalste und größte Polizeieinsatz“ gewesen, urteilt Detlef Michelers in seinem Buch zu den Straßenbahnunruhen, das sinnigerweise den Spruch des obersten Polizisten im Titel führt.
Die Rolle von Bürgermeister Hans Koschnick

Der 38-jährige Bürgermeister Koschnick war kaum im Amt, als er mit den „Straßenbahnunruhen“ seine erste Bewährungsprobe zu meistern hatte – und nach eigenem Eingeständnis scheiterte. (Jochen Stoss)
Widersprüchlich bleibt die Rolle von Bürgermeister Hans Koschnick, damals gerade einmal gut anderthalb Monate im Amt. Dass er die Proteste nicht ernst genug genommen hätte, kann man ihm kaum vorwerfen, er selbst hat es vor dem später eingesetzten Untersuchungsausschuss auch vehement bestritten. Eigentlich plädierte Koschnick für eine besonnene Haltung, noch kurz vor Ausbruch der Straßenbahnunruhen hatte er im Dezember 1967 angesichts ähnlich gelagerter Unruhen in Köln zu Dialogbereitschaft gemahnt. Doch als sich die Lage auch in Bremen zuspitzte, wollte er davon nichts mehr wissen. Plötzlich gab der 38-Jährige den Law-and-Order-Politiker, dem Druck der Straße wollte er nach eigenem Bekunden nicht nachgeben. „Auf Terror muss mit Gewalt regiert werden“, zitierten ihn die Bremer Nachrichten.
Freilich war Polizeigewalt auf Dauer keine Lösung. Zumal die jungen Leute sich nicht einschüchtern ließen, nach Schulschluss und Arbeitsende strömten in den späten Nachmittagsstunden von Tag zu Tag mehr Demonstranten in die Innenstadt, zuletzt fanden sich 20.000 ein. Darunter vermehrt auch Lehrlinge und Arbeiter, der Betriebsrat der Klöckner-Hütte solidarisierte sich mit den Demonstranten. Ein Hauch von Revolution lag in der Luft. Kein Wunder, dass der damalige Gewerkschaftsboss Richard Boljahn kalte Füße bekam. In seiner Doppelfunktion auch als SPD-Fraktionschef hatte der damals 56-Jährige anfangs zu den Hardlinern gehört, doch nun schwante ihm Böses. „Die Arbeiter kommen, die Stimmung wendet sich gegen uns“, warnte er Koschnick.
Nach den Prügelorgien der beiden vorangegangenen Tage hielt sich die Polizei am Freitag, 19. Januar, auf Geheiß des Senats zurück. Eine angespannte Stimmung herrschte in der Stadt. Man konnte sich nicht sicher sein: War es nun die Ruhe vor oder nach dem Sturm? Abermals hatten sich Zigtausende auf der Domsheide versammelt und harrten der Dinge, die da kommen würden. Koschnick weilte zu diesem kritischen Zeitpunkt nicht in der Stadt, er hatte sich zu einer Ministerrunde nach Düsseldorf begeben und das Zepter an seine Stellvertreterin übergeben, Jugendsenatorin Annemarie Mevissen.
Bis dahin zählte sie eher zu den Falken, nach den ersten Zusammenstößen hatte sie weitere Polizeieinsätze noch mit dem Argument gerechtfertigt, es gebe nur die Wahl zwischen „Terror oder Ordnung“. Doch nun besann sie sich eines Besseren und setzte sich im Rathaus mit den Schülervertretern an einen Tisch. Wobei zu erwähnen ist, dass der Termin nicht auf ihr Betreiben zustande kam, sondern schon vorher vereinbart worden war. Eigentlich erst für den folgenden Montag, wegen der brisanten Lage hatten die Schüler aber aufs Tempo gedrückt.

Horst-Werner Franke, damals SPD-Bürgerschaftsabgeordneter, diskutierte per Megafon mit den Demonstranten. (Jochen Stoss)
Stundenlange Verhandlungen
Wirklich wohl war Mevissen nicht in ihrer Haut, in ihren Erinnerungen spricht sie mit spürbarer Distanz vom „Rädelsführer“ der Straßenbahnunruhen, den sie irrtümlich Rademacher nennt ‒ in Wahrheit handelte es sich um Hermann Rademann, einen 20-jährigen Jurastudenten aus Vegesack. Mehrere Stunden verhandelten die Konfliktparteien, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Doch immerhin sprach man miteinander, eine klare Aufwertung der Protestbewegung.
Von einem Auftritt auf der Domsheide war zunächst keine Rede. Im Nachhinein hat dieses Bild geradezu ikonenhafte Bedeutung erlangt: die stellvertretende Bürgermeisterin inmitten der brodelnden Masse mit dem Megafon auf einer Streusandkiste. In irgendeiner Form abgestimmt war dieser Schritt laut Helmut Fröhlich nicht, nach Erinnerung des späteren Innensenators handelte es sich um eine „spontane Entscheidung“. Das bestätigt Mevissen in ihrem Rückblick: Von den Jugendlichen sei sie um eine Ansprache gebeten worden, „um die Polizei auf Distanz zu halten“.
Schon mit ihren ersten Worten löste sie den Bann. Ihre Bemerkung, es handele sich um eine „legale Demonstration zu einer Sachfrage“, fand Eingang in die Geschichtsbücher. Nur in ihren eigenen Memoiren liest man merkwürdigerweise nichts davon ‒ sie wisse „natürlich nicht mehr“, was sie im Einzelnen gesagt habe, schreibt Mevissen. Wichtig sei ihr aber die Dialogbereitschaft gewesen, das wechselseitige Verständnis für die Argumente der Gegenseite.
Fortan gab es keine Polizeigewalt mehr und keine Randale. Am Wochenende blieb es ruhig, zweimal stellte sich Bürgermeister Koschnick kurz danach mehreren Tausend Demonstranten auf dem Domshof. Vorher suchte er freilich noch den Rat des Parteigenossen Dinné. „Koschnick rief mich an und fragte, was er tun sollte“, berichtet Dinné. Seine Antwort: sich den Demonstranten stellen und die Tariferhöhungen zurücknehmen. Bei der ersten Kundgebung am Montag, 22. Januar 1968, machte Koschnick allerdings noch keine Zugeständnisse. „Es wurde für ihn eine äußerst bittere Demonstration“, schreibt Mevissen. Rademann nutzte seine neu gewonnene Machtposition und stellte dem Bürgermeister ein Ultimatum: entweder ein greifbares Ergebnis binnen 48 Stunden oder Wiederaufnahme der Proteste.

Gemeinsam mit Hermann Rademann vom Unabhängigen Studentenbund rief Mevissen die Demonstranten zur Besonnenheit auf. Die Bürgermeisterin hatte Erfolg mit ihrem Appell – wohl auch, weil sie Verständnis für die Schüler und Studenten geäußert hatte. (Landesinstitut für Schule / Jochen Mönch)
Teilweise Rücknahme der Tariferhöhungen
Die Drohung zeigte Wirkung. Zwei Tage später, am 24. Januar 1968, kündigte Koschnick auf der zweiten Domshof-Kundgebung zumindest die teilweise Rücknahme der Tariferhöhungen an. Nur auf Rademanns Forderung, dem verhassten Polizeipräsidenten von Bock und Polach den Laufpass zu geben, wollte er sich nicht einlassen. Gleichwohl konnte die Protestbewegung einen völlig unerwarteten Erfolg feiern, für das Selbstbewusstsein der Teilnehmer waren die „Straßenbahnunruhen“ von kaum zu unterschätzender Bedeutung. „Die Stimmung war: Wir haben gewonnen“, erinnert sich Barloschky.
Als „Marginalie“ bewertet indessen der damalige Bildungssenator Moritz Thape die Ereignisse. Sein Befund: Die Presse habe „Freude an der Kriegsberichterstattung“ gefunden, ohne ihre Unterstützung hätte die Bewegung keinen Erfolg gehabt. Zumindest in diesem Punkt gibt Buchautor Michelers dem streitbaren Sozialdemokraten recht. Als „liberal und kritisch“ würdigt er die Rolle der Tagespresse, andernfalls wären die Proteste „vielleicht nur eine lokale Marginalie“ geblieben.
So verschieden kann die Wahrnehmung historischer Ereignisse sein. Nicht nur die Zukunft, auch die Vergangenheit lässt sich eben manchmal nur schwer vorhersagen.
von Frank Hethey
Hier lesen Sie mehr über die Ausschreitungen im Jahr 1968.

Die Demonstranten machten unmissverständlich deutlich, was sie von der Fahrpreiserhöhung hielten. (Focke Museum)