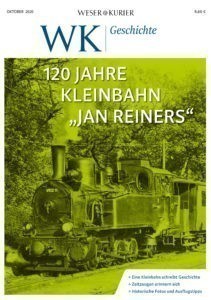Engagierte Vorleser: Peter Lüchinger, Petra-Janina Schultz, Markus Seuß, Erik Roßbander.
Foto: Marianne Menke
Premiere am Leibnizplatz: Bremer Shakespeare Company bringt „Bremen: Eine Stadt der Kolonien?“ auf die Bühne / Szenische Lesung aus der Reihe „Aus den Akten auf die Bühne“
Nichts an dieser Premiere war so interessant wie der Fall des Johannes Kohl. So „urdeutsch“ der Name auch klingt – tatsächlich handelte es sich um einen Schwarzen aus der früheren deutschen Kolonie Togo, der in den späten 1920er Jahren in Bremen um die deutsche Staatsbürgerschaft kämpfte. Gar nicht einmal nur für sich selbst, sondern vor allem, weil er so seinen unehelichen Sohn aus der Verbindung mit einer Deutschen legitimieren wollte. Das Überraschende: Die Bremer Behörden unterstützten sein Ansinnen und warnten vor den Folgen für das Kind, sollte er mit seinem Antrag scheitern. Eine verzwickte Situation, weil in Einbürgerungsfragen sämtliche Länder und das Auswärtige Amt ein Mitspracherecht hatten.
Kohl befand sich also mitnichten „im Nahkampf mit den Bremer Behörden“, wie es unlängst hieß. Ganz im Gegenteil, die geschmähten Behörden schlugen sich auf seine Seite, sie unterstützten seinen Kampf um den verlorenen Sohn. Die Sache ging nach ganz oben: Im Dezember 1928 setzte sich sogar Bürgermeister Martin Donandt persönlich für Kohl ein. Derselbe Donandt, der als einer der eifrigsten Fürsprecher des Kolonialgedankens gilt. Ein strammer Nationalist, der Demokratie als Teufelswerk ansah. Und so einer fordert das Bürgerrecht für einen Schwarzen?
Der Fall Kohl war nicht das einzige Überraschungsmoment bei der Premiere der szenischen Lesung „Bremen: Eine Stadt der Kolonien?“ am Dienstagabend im Theater am Leibnizplatz. Wer die große Moralkeule erwartet hatte bei dem nun schon zehnten Stück aus der Reihe „Aus den Akten auf die Bühne“ sah sich eines Besseren belehrt, erstaunlich unspektakulär klingen prominente Protagonisten des Kolonialgedankens in ihren Selbstzeugnissen – die Banalität des Bösen lässt grüßen.
Die Eingeborenen „scheinen nicht ganz ohne Intelligenz zu sein“
Nicht brutal und verschlagen, sondern nüchtern und geschäftsmäßig hört sich in seinen Briefen der Bannerträger des deutschen Kolonialismus an, der doch sonst so übel beleumundete Kaufmann Adolf Lüderitz.
Und unfreiwillig komisch, was sein Berufsgenosse Heinrich Vogelsang in seinem Tagebuch notierte. Die Eingeborenen „scheinen nicht ganz ohne Intelligenz zu sein“, stellte er verblüfft fest, ihr König habe sogar ein „etwas imponierendes Gesicht“.
Einigermaßen unerwartet dann aber, wie viel Respekt der zuletzt völlig aussichtslose Guerillakrieg des Chiefs Mkwawa in Ostafrika den deutschen Besatzern abnötigte. In seinem Verzweiflungskampf sei er ein „uns sympathischer Despot“, hieß es da schon mal. Das klingt fast so, als habe man ein bisschen sich selbst wiedererkannt im unbeugsamen Widerstand des „letzten Sultans“. Auch einer, der um seinen „Platz an der Sonne“ kämpfte – wie das noch junge deutsche Reich im Konzert der etablierten imperialistischen Kolonialmächte. Da dürfte auch das Bild des „edlen Wilden“ eine Rolle gespielt haben. Eine Denkfigur, die Karl May mit seinem Winnetou so gut bediente wie kaum ein anderer.
Und plötzlich als postkoloniales Phänomen der durchaus ehrenwerte Einsatz des Bremer Jugendamts im Falle Kohl. Eine denkende Behörde, eine mutige Behörde – das ist ganz gewiss keine Alltagserscheinung, schon gar nicht in Zeiten der Weimarer Republik. Zumal auch noch anerkennende Worte zu hören sind für das „gewagte Ehebündnis“ mit einer gebürtigen Bremerin.
Humane Haltung des Bremer Jugendamts
Das kann man natürlich ins Gegenteil verkehren, weil es nicht passt in das einfache Gut-und-Böse-Schema. Eine verständnisvolle Behörde, ein kämpferischer Landesvater – beide auf Seiten des Johannes Kohl. Harter Tobak für alle, die lieber nicht differenzieren wollen. Die im buchstäblichen Sinne des Wortes dem Schwarz-Weiß-Denken huldigen. Eigentlich ein Jammer, wenn man sich selbst so sehr beschneidet in seinem eigenen Denken. Ergeben sich die interessantesten Einsichten und Perspektiven doch gerade dann, wenn man versucht, eine einleuchtende Erklärung zu finden für Dinge, die so gar nicht zusammenpassen wollen.
In ihrem Beitrag über den Fall Kohl im Begleitband verhehlt Anda Nicolae Vladu nicht, wie erstaunt sie war über die positive Haltung des Bremer Jugendamts. Fast übervorsichtig räumt sie ein, damit werde „zumindest ein wenig an den gängigen rassistischen Annahmen“ gerüttelt. Das kann man wohl sagen. Merke: Nicht alles war schlecht in der „guten alten Zeit“, sogar eine Behörde konnte human agieren, sogar ein nationalistischer Bürgermeister hatte ein Gewissen.

Großer Auflauf: Veranstaltung am „Reichskolonial-Ehrenmal“ bei der Reichskolonialtagung in Bremen 1938.
Quelle: Bildbestand der Deutschen Kolonialgesellschaft in der Universitätsbibliothek Frankfurt am Main
Vielleicht ist das gar nicht einmal so widersprüchlich, wie es auf den ersten Blick scheint. Auch wenn führende Kolonialrevisionisten sich fast durchweg als etwas Besseres dünkten und mehr oder weniger offen das weiße „Herrenmenschentum“ propagierten, gab es doch so etwas wie ein Loyalitätsgefühl gegenüber den schwarzen Untertanen von einst. Das lässt sich nicht nur bei dem „Helden von Deutsch-Ostafrika“ nachweisen, dem in Bremen ansässigen General Paul von Lettow-Vorbeck. Es wäre zu billig, solchen Bekundungen jegliche Lauterkeit abzusprechen, darin einfach nur zynisches Gehabe zu sehen.
Widersteht man dieser Versuchung, verliert auch der Donandt-Vorstoß viel von seiner Rätselhaftigkeit. Ganz offenbar fühlte er eine moralische Verpflichtung, sich für den so ganz und gar deutschen Kohl stark zu machen. Und das vielleicht gerade weil er dem Kolonialgedanken so zugetan war, weil er sensibilisiert war für alles, was damit zusammenhing. Dass er darüber nicht zum Wegbereiter schwarzer Emanzipation wurde, dass er eilfertig von einem Einzelfall sprach und gern eingestand, wie wichtig völkische Erwägungen seien, versteht sich von selbst.
Hitler als Fürsprecher verdienter „Kolonialneger“
Dass die Schauspieler der Bremer Shakespeare Company dem Fall Kohl so viel Platz einräumen, ist ihnen hoch anzurechnen. Es gab eben nicht nur „Bremens koloniale Schande“, es gab auch so etwas wie Schamgefühl im Umgang mit menschlichen Schicksalen. Dass sich das sogar noch eine Weile nach der NS-Machtübernahme hielt, möchte man kaum glauben, die Zuhörer vernahmen es mit Erstaunen. Doch es ist historisch verbürgt, dass NS-Reichsleiter Martin Bormann im Oktober 1935 dem Auswärtigen Amt mitteilte, Hitler wolle nicht, dass verdienten „Kolonialnegern“ unnötig Steine in den Weg gelegt würden.
Freilich ließ die Kehrtwende nicht lange auf sich warten, nur ein Jahr später zogen auch die Bremer Behörden andere Seiten auf. Plötzlich war Kohls Verbindung zu einheimischen Frauen eine „Kultur- und Sittenwidrigkeit“, wollte man ihm allenfalls noch Umgang zubilligen mit den Prostituierten in der Helenenstraße. Seine persönliche Freiheit blieb bald auf der Strecke, den Krieg überstand Kohl gerade mal eben so als Zwangsarbeiter bei der AG Weser.
Nicht wirklich begreiflich ist, warum im Titel des Stücks überhaupt die Frage aufgeworfen wird, ob Bremen eine Stadt der Kolonien gewesen sei. Zu erklären ist das eigentlich nur mit dem Versuch, das damalige Selbstverständnis der Stadt nicht ohne weiteres unkritisch zu übernehmen. Denn Bremen war nach eigener Wahrnehmung ohne jeden Zweifel nicht nur eine, sondern die „Stadt der Kolonien“. Und tat alles dafür, auch in der Außenperspektive klare Verhältnisse zu schaffen.
Einflussreiche Koloniallobby an der Weser
Es ist ja kein Zufall, dass ein „Kolonialheld“ wie Lettow-Vorbeck sich ausgerechnet in Bremen niederließ. An der Weser gab es einflussreiche Gönner, eine starke Koloniallobby. Als alte Handelsstadt mit zahlreichen überseeischen Verbindungen gingen von Bremen entscheidende Impulse beim Aufbau des deutschen Kolonialreichs aus. Und das anfangs sogar gegen den Widerstand Bismarcks, der fürchtete, das gerade erst vereinte Deutschland würde sich damit übernehmen und ohne Not internationale Konflikte mit den etablierten Kolonialmächten heraufbeschwören. Dass er dann doch nachgab, hat nicht zuletzt zu tun mit dem unablässigen Wirken einer Koloniallobby, die auch in Bremen beheimatet war und mit den eigenmächtigen Vorstößen von Kaufleuten wie Lüderitz, die einfach mal vollendete Tatsachen schufen.

Martialisch: Wachen in der Uniform der Schutztruppe 1938 am Kolonial-Ehrenmal.
Quelle: Bildbestand der Deutschen Kolonialgesellschaft in der Universitätsbibliothek Frankfurt am Main
Kein Wunder, dass Bremen schon zu Kaisers Zeiten für sich in Anspruch nahm, eine „treue Hüterin“ des Kolonialgedankens zu sein. Und sich nach dem Ende des deutschen Kolonialreichs infolge der Niederlage im Ersten Weltkrieg als Sachverwalter des Kolonialgedankens verstand. Denn mit dem dauerhaften Verlust der Kolonien wollte man sich nicht nur an der Weser keineswegs abfinden, innerhalb kurzer Zeit avancierte Bremen zum „Zentrum der kolonialrevisionistischen Bestrebungen“.
Dass der rote Klinkerelefant als gesamtdeutsches „Kolonial-Ehrenmal“ 1931 seinen Platz in Bremen fand und nicht irgendwo anders war ein sichtbares Zeichen für Bremens Alleinvertretungsanspruch in Kolonialfragen. Auch das heutige Übersee-Museum sah man als Baustein im kolonialen Kontext an, zusätzlich geplant war eine Schulungsstätte für Kaufleute in den zurückgewonnenen Kolonien. Dazu passt, dass Bremen 1938 als Gastgeber der Reichskolonialtagung fungierte. Und auch, dass die Große Weserbrücke im Juli 1939 in Lüderitz-Brücke umbenannt wurde – alles, um das eigene Image als „Stadt der Kolonien“ zu untermauern. Erst mit Kriegsausbruch war es vorbei mit der Kolonialeuphorie, der „Lebensraum im Osten“ war wichtiger als „ein Platz an der Sonne“.
Ein komplexer Stoff, keine Frage. Und sicher eine echte Herausforderung, aus 600 Seiten Aktenmaterial 50 Seiten für die szenische Lesung zu destillieren. Eine Aufgabe, um die Peter Lüchinger ganz gewiss nicht zu beneiden ist. Gleichwohl wird die Geduld der Zuschauer auf eine ziemlich harte Probe gestellt. Allein bis zur Pause vergehen schon anderthalb Stunden – manch einer im Publikum war der irrigen Meinung, damit sei das Stück zu Ende. Doch weit gefehlt, fast eine ganze weitere Stunde schloss sich dem opulenten Vorlauf an. Und erst jetzt schälte sich der Bremen-Kontext heraus, von dem zuvor so gut wie überhaupt keine Rede war. Da stimmt die Gewichtung nicht, da wäre weniger mehr gewesen – nicht im zweiten, aber im ersten Teil.
Ein bisschen mehr Selbstdisziplin bei der Auswahl der Zitatpassagen würde der Lesung ganz sicher guttun. Dazu könnte wohl auch Eva Schöck-Quinteros beitragen, die verdienstvolle Macherin der Reihe „Aus den Akten auf die Bühne“. Indem sie nämlich beim nächsten Projekt den Aktenstoß für die Umsetzung auf der Bühne ein wenig reduziert. Freilich dürfte das einfacher gesagt sein als getan. Auch der Autor dieser Zeilen wollte seine Premierenkritik um der guten Lesbarkeit willen eigentlich um einiges kürzer halten. Doch das mit der Selbstdisziplinierung ist eben so eine Sache.
von Frank Hethey
Weitere Lesungen im Theater am Leibnizplatz am 19. und 26. September sowie am 25. Oktober um jeweils 19.30 Uhr.
Eintritt: 13 EUR /erm. 6 EUR