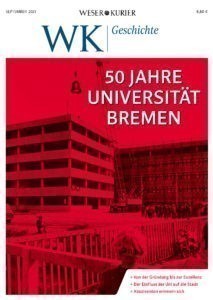Ausflug zum Werder-Heimspiel mit Zwischenstation in der Helenenstraße
Im März 1993 erhalte ich einen Anruf von meinem Freund Jürgen Dragowski, der zu dieser Zeit beim Bremer Fan-Projekt aktiv ist. Ob ich nicht Lust hätte, mich mit meinen muttersprachlichen Kenntnissen nützlich zu machen und eine Gruppe englischer Fans vor dem nächsten Heimspiel zu betreuen?
„Aber sicher. Wo kommen sie her?“
„Leeds.“

Als brutaler Klopper übel beleumundet: Jackie Charlton, der ältere Bruder des legendären Bobby Charlton.
Quelle: soccersignatures.co.uk
Mein Schweigen ist offensichtlich lang genug, um Jürgen nachfragen zu lassen, ob ich noch da sei.
„Ja, warum nicht? Klar. Mache ich.“
Begeisterung höre sich anders an, erwidert er. Ob ich Bedenken hätte.
Leeds United gehörte für mich in meiner Kindheit und Jugend in eine Schublade mit der Aufschrift „Das Böse“: schlimmer als die Spurs aus Tottenham, schlimmer als Arsenal, die den langsamsten und langweiligsten Fußball spielten, den man sich vorstellen konnte, schlimmer sogar als die Stadtrivalen Man City. Eine Kloppertruppe, deren zweifelhaftes Aushängeschild der große schlaksige Bruder „meines“ Bobby Charlton war: der brutale Vorstopper Jackie. In den Siebzigern war es der rotschopfige schottische Mittelfeldbeißer Billy Bremner gewesen, der diese Rolle inne hatte und ganz Fußball-Europa unsicher machte – zu einer Zeit also, als mein United gerade am Absteigen war. Hinzu kam, dass sie seit den Sechzigern eine Anhängerschaft hatten, die sich im Skinhead-Milieu tummelte und mit entsprechend rechten Parolen daherkam.
„Bedenken. Wie soll ich Bedenken haben. Lass die kommen.“
Heinrich Heine hätte seinen Spaß gehabt
Am Samstagmorgen trafen wir uns hinter der Ostkurve, von wo aus wir mit einem Vereinsbus in die Stadt gebracht wurden. Wir sollten nach dem Sightseeing zurück zum Stadion laufen, um die Eintrittskarten für die Gruppe abzuholen. Es war eine lustige Bande, zwar ein paar Skins dabei, aber ohne Spuren von Rassismus oder sonstigen Auffälligkeiten. Ich bot ihnen das ganze Stadtmitte-Programm – Rathaus (ach wie köstlich die entsetzten Gesichter der Essenden, als ich mit ‚meinen’ Skinheads die Treppe zum Ratskeller herunter kam; Heinrich Heine hätte seinen Spaß daran gehabt); Dom; Böttcherstraße; Schnoor; Martinianleger. Die Jungs waren entsprechend beeindruckt. Ihre Heimatstadt im Norden, einst die Woll- und Maschinenbau-Hauptstadt Englands, war zu einem grauen Slum verkommen, das erst später durch Hightech und den Dienstleistungsbereich neuen Glanz erwerben sollte. So zeigte der den Touristen vorgegaukelte hanseatische Glanz Bremens durchaus Wirkung.
Dann war es Zeit, sich auf den Rückweg zum Stadion zu machen. Weil die Jungs den Fluss schon gesehen hatten, entschied ich, nicht an der schönen Weserpromenade zurückzulaufen, sondern durch Bremens spannendes „Viertel“ zu gehen, das eine breite Palette von Freizeitangeboten bietet: Bars, Cafés, Restaurants, Kiosks, aber auch gemütliche Wohnnebenstraßen, drei Supermärkte, zwei Kinos, Videoverleihe, türkische und arabische Lebensmittelläden und – ach ja, und die Helenenstraße.
„Unsere“ Bordellstraße befindet sich seit 1878 weder in einem schmuddeligen Bahnhofsviertel noch, wie in Hamburg, als Touristen- und Bauernfalle in einem separaten Stadtteil, sondern – um „controllierte und reglementierte Prostitution“ zu ermöglichen – mitten in diesem zentralen Wohngebiet, wo Abend für Abend Clubber auf Gassi gehende Rentner treffen, wo nachmittags feine Damen Kaffee und Kuchen und abends Schüler Döner zu sich nehmen. Bis vor circa zehn Jahren war der Zutritt zur Helenenstraße für weibliche Personen, die keine Huren waren, verboten. Minderjährigen ist der Zutritt immer noch untersagt. Der Eingang ist so schmuddelig wie eindeutig: primitiv gemalte halbnackte Mädels heißen einen willkommen.

Auf Tuchfühlung: Beim Rundgang durch Bremen kamen sich Ian Watson (Mitte, mit Bart) und die Gäste aus Leeds näher.
Bildvorlage: Ian Watson
„What’s that, Ian?“
Als wir uns dem Ziegenmarkt nähern, der gegenüber der Helenenstraße ist und samstags einen Ökomarkt bietet, wird mir mulmig. Andy, einer der jüngsten aus Leeds, sieht die beiden angemalten Damen und fragt: „What’s that, Ian?“
„Nothing“, antworte ich, aber es ist zu spät. Die ersten beiden sind schon drin, und deren Begeisterungsschreie ziehen den Rest hinein.

Ian Watson: Spielfelder – eine Fußballmigration
184 S., 22 Abbildungen
Edition Falkenberg: Bremen 2016
14,90 Euro
ISBN 978-3-95494-097-4
Als Betreuer muss ich natürlich hinterher, und plötzlich stehe ich dort, wo ich in über zwanzig Jahren Bremen nie gestanden habe. Ich hole die Gruppe zusammen und versuche, alles historisch zu erklären, wie in der Böttcherstraße und im Schnoor. Bei der Erwähnung der kontrollierten und reglementierten Prostitution gibt es weitere Freudenschreie: „Yeah. Right on! Coool.“
Für Briten ist legalisierte und offene Prostitution in dieser Form einfach undenkbar. Die ersten Huren schauen raus und fragen, was vorgeht. Hoffentlich holen sie keine Polizei, nicht zuletzt, weil ein Vierzehnjähriger dabei ist. Das sage ich nun auch, aber ohne nennenswerten Erfolg. Erst als ich darauf hinweise, dass wir um 13 Uhr zum Empfang am Stadion sein müssen und noch ein bisschen zu laufen haben, machen sie Anstalten umzukehren. Wir tauchen wieder ins geschäftige Alltagsleben des Viertels: Autos, Biomarkt, Radfahrer, Einkaufstüten.
Und genau dort, vor dem Supermarkt, steht neben einer älteren Frau (Oh mein Gott – ihre Mutter?) eine meiner Studentinnen, bildhübsch, mit klaren blauen Augen, die gerade Blickkontakt mit mir finden. Sie hebt die Hand zum Gruß, doch plötzlich fällt ein Schatten über ihr Gesicht und ihr Lächeln erlischt. Sie begreift zweierlei: dass ich aus der Helenenstraße komme und dass ich offensichtlich Anführer einer Skinhead-Hooliganbande bin. Nein, so einen stellt man der Mutter nicht vor. Ich versuche es mit einem hilflosen Blick: Ich weiß, was du denkst, aber ich kann wirklich nichts dafür. Aber da hat sie sich schon längst weggedreht. Am Montag war sie nicht im Seminar.
von Ian Watson
Abdruck aus Ian Watson, Spielfelder: eine Fußballmigration. Edition Falkenberg | ISBN 978-3-95494-097-4 | lieferbar ab 2. Juni 2016