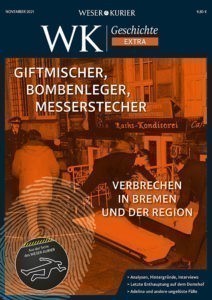Da sind sie wieder: die Untergangsszenarien. Vielleicht schon in diesem, spätestens aber im kommenden Jahr werde der Euro implodieren, heißt es. Die Auguren dieser düsteren Zukunft haben gute Argumente, vor allem eines: Italien. Es sind nicht nur die 2,3 Billionen Euro Schulden, die das Land inzwischen angehäuft hat, sondern die Aussichten, dass die gerade installierte Regierung darauf nur eine Antwort hat: noch mehr Schulden machen. Die Wahlgeschenke eines höheren Mindestlohns und zusätzlichen staatliche Leistungen dürften sich auf rund 120 Milliarden Euro im Jahr summieren. Alle Versprechungen in Zeiten radikaler Spar-Zusagen in der Finanzmarktkrise scheinen vergessen.
Griechenland war übel, aber nun geht es um das drittgrößte Land der Währungsunion. Noch dazu eines, das seine Schuldenlast noch nie wirklich zurückgefahren hat. Das Vertrauen der Anleger schwindet, die Risikozuschläge für frisches Kapital klettern bereits nach oben. Alle Instrumente, die sich die Euro-Zone seit 2012 zugelegt hat, wären überfordert, diesen Staat zu retten oder wenigstens zu stabilisieren.
Die Schockwellen ziehen bereits Kreise. Auch in Spanien stiegen die Zinsen für Staatsanleihen, die Börsen brachen ein. Nicht einmal mehr die Europäische Zentralbank könnte auf Dauer helfen – und wollen. Anfang Juni verkündete der (italienische!) Präsident der Euro-Bank, Mario Draghi, das Ankauf-Programm für Staatsanleihen werden Ende des Jahres auslaufen. Rom hätte ohnehin nichts davon, denn zu den Grundvoraussetzungen für Hilfen aus Frankfurt zählt die Unterwerfung unter ein Rettungsprogramm der Währungsunion. Das aber will die seltsame Koalition aus rechtsextremer Lega Nord und linksgerichtete Fünf-Sterne-Bewegung auf keinen Fall. Wie lange dauert es, bis Italien bankrott ist? Und den Euro mit in den Abgrund reißt?
Der Euro in der gesamten Europäischen Union
In dieser Situation träumt Brüssel von einer ganz anderen Zukunft der Gemeinschaftswährung: Bis 2025 sollen alle EU-Mitgliedstaaten mit dem Euro zahlen. Schließlich sind sie vertraglich dazu verpflichtet. Nun sollen etliche Milliarden in die Hand genommen werden, um die noch rückständigen Mitgliedstaaten ökonomisch so aufzupäppeln, dass sie mithalten können – vielleicht nicht mit dem Marktführer Deutschland, aber doch wenigstens mit dem EU-Durchschnitt. Die vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron betriebene Reform der Eurozone mit eigenem Etat, mit einem eigenen Europäischen Währungsfonds und weiteren Stabilisierungsinstrumenten hat genau dieses Ziel: Aus Europa einen Euro-Raum zu machen, der hält – wenigstens wirtschaftlich, wenn er schon nicht politisch zusammenwächst.
Dabei scheint genau das das Problem. Die Zentrifugalkräfte haben in dieser Gemeinschaft zugenommen. Praktisch der gesamte Osten der Union verweigert sich einem neuen gemeinsamen Asylrecht, Polen und Ungarn liegen im Dauer-Clinch mit der Brüsseler Kommission. Das hat deshalb so viel mit dem Euro zu tun, weil der Konsens über gemeinsame Regeln abnimmt. Eine Währungsunion kann man aber nicht in eine monetäre Gemeinschaft und einen wild gewordenen Haufen politischer Egoisten auseinanderfallen lassen.
Dabei haben die Differenzen in wichtigen Fragen unweigerlich ökonomische Konsequenzen. Wenn Grenzkontrollen und massive Schuldenprobleme die Union belasten, wird die bisherige Arbeitsteilung nahezu unmöglich. Der Binnenmarkt wäre am Ende. Vielleicht würde Deutschland mit seinen gewaltigen Exportüberschüssen eine tiefe Rezession überleben, viele andere aber nicht.
Macrons Vorschlag zur Sanierung der Euro-Zone enthält einen Punkt, vor dem deutsche Regierungsmitglieder regelmäßig zurückschrecken, der aber dennoch die Lösung enthält: die Vergemeinschaftung der Schulden. Für viele die einzige Lösung. Auch für den Euro. Denn eben diese Haftungsgemeinschaft würde, so die Befürworter, durch ihren Zusammenschluss die Unauflöslichkeit des Währungsraumes festschreiben. Sie sehen in dem Eintreten der Starken für die Schwachen so etwas wie die Grundvoraussetzung für einen auch politisch monolithischen Block, der seine Schulden gemeinsam trägt und auch zusammen dafür einsteht – beispielsweise, in dem man eine neue Schuldenagentur gründet, in die alle Altschulden wie bei einer Bad Bank einfließen und von der neue Schulden bis zu einem festgelegten maximalen Prozentsatz am Sozialprodukt der jeweiligen Länder begeben werden können. Gemeinsame Bonds wären das geeignete Signal an die internationalen Finanzmärkte, heißt es.
In Deutschland halten viele dies für eine reichlich blauäugige Theorie. Es mache keinen Sinn, die Starken schwach zu machen, weil dann alle schwach wären. Deshalb sei es nötig, dass jeder zuerst seine Verbindlichkeiten bedient, Schulden abräumt, Risiken beseitigt – dann, und erst dann, könne man sich auch finanziell miteinander verbünden.
Die Wähler müssen umdenken
Doch beide Sichtweisen haben ihre Schwächen. Weil es nicht nur die Regierungen sind, die umdenken müssen, sondern in der Folge (oder sogar zuerst?) die Wähler. Es sei eine neue Sicht des modernen Staates notwendig, heißt es. Ein Gemeinwesen also, das nicht mehr das Füllhorn staatlicher Leistungen über seine Bürger ausgießt – und zwar auch dann noch, wenn es nichts mehr zu verteilen gibt. Entweder weil die Sozialsysteme nicht auf den neuesten Stand (Rückgang der Beitragszahler, Zunahme der Anspruchsberechtigten wie zum Beispiel Rentner) gebracht wurden. Oder weil eine überbürokratisierte Verwaltung ineffizient arbeitet. Oder weil die Abgabensysteme des Staates private Initiative ersticken, weil es sich nicht mehr lohnt: Wer zahlt schon gerne bis zu 56 Prozent Steuern wie in Belgien?
Ohne politische Reformen aber gibt es nicht nur keine Euro-Stütze aus Brüssel oder Luxemburg, sondern auch auf dem Kapitalmarkt nur zu Zinssätzen, die unerträglich sind. Mehr noch: In ein solches Gemeinwesen pumpt niemand Geld, weil er ahnt, dass es gleich wieder versickert. Das Credo des Euro-Raums, dem zufolge Reformen die Voraussetzungen für Hilfe sind, ist kein Diktat, sondern eine Erkenntnis – egal was die italienische Regierung ihren Bürgern klarmachen will.
Der Euro ist keine Medizin zur Heilung, sondern das Ergebnis einer erfolgreichen Behandlung. Die Maastrichter Stabilitätskriterien waren nie Stolpersteine, sondern eine Errungenschaft, weil sie die Staaten zum soliden Haushalten verpflichteten. Die darin eingeschlossenen Kontrollmechanismen verhindern, dass populistische Regierungen sich einen Teufel um das scheren, was ihre Vorgänger versprochen hatten.
Dies einzusehen, sollte nicht so schwerfallen. Allen Unkenrufen zum Trotz hat der Euro viel Stabilität und Wachstum in diese Union gebracht. Allerdings haben keineswegs alle, die ein Regierungsamt ausüben oder ausgeübt haben, diese Lektion auch verstanden. Kostspielige Wahlgeschenke verpuffen, weil sie nicht nachhaltig sind. Kein Rentner hat etwas davon, wenn ihm höhere Ruhestandsbezüge versprochen werden, für die er sich im nächsten Monat auch nur soviel kaufen kann wie heute.
Wer an diesen Tatsachen zweifelt, kann sich gerne erkundigen und in Spanien, Portugal, Irland und anderen Ländern nachfragen, die unter den diversen Rettungsschirmen der Euro-Familie wieder gesundet sind. Unser Geld brauchte eine stabile Gemeinschaft, keinen zerstrittenen Haufen von Staaten, von denen einige glauben, sie könnten Haushaltspolitik mit den Mitteln des letzten Jahrhunderts betreiben. Wohin geht der Euro?
Von der Währungsunion zur Einheit
Seine Mütter und Väter sahen ihn nie nur als ökonomisches, sondern immer auch als ein politisches Projekt, Europa zusammenzuführen und die Einheit unumkehrbar zu machen. Es gab Geburtsfehler, monetäre Schieflagen, die aus politischen Gründen geflissentlich übersehen wurden. Das funktioniert nicht mehr, weil Schwierigkeiten nur neue Probleme nach sich ziehen.
Italien hat sich nie wirklich reformiert, Griechenland musste erst dazu gezwungen werden – und bleibt auch nach dem Auslaufen des dritten Hilfspaketes unter Beobachtung. Damit Erreichtes nicht wieder aufs Spiel gesetzt wird. Und weil der Euro Kreise ziehen soll. Denn die Botschaft der Währungsunion lautet: Wer zu uns gehört, wirtschaftet gut, hat einen soliden Haushalt, gute Wettbewerbsbedingungen und versteht Schulden nicht als Stilmittel seiner Politik. Italien wird das erst noch lernen müssen. Die Herausforderungen, vor denen das Land steht, sind nicht vom Euro, sondern von unfähigen Regierungen verursacht oder wenigstens nicht bekämpft worden.
Um den Euro muss einem nicht bange sein, so lange die Union weiß, dass sie nur als Gemeinschaft wirklich weiterkommt und Erfolg hat. Das Ziel einer Vergemeinschaftung von Risiken und Verantwortung ist hoch – und vielversprechend. Aber die Währungsunion kann nicht auffangen, was die Staaten selbst nicht bereit sind, anzugehen. Die Euro ist die Belohnung dafür, dass sie es geschafft haben. Und nur dann hat er auch eine Zukunft.
Die Chancen dafür sind übrigens gut. Auch wenn zu viele über die Handelsstreitigkeiten mit den Vereinigten Staaten klagen, so gibt es dennoch eine andere Seite: Die Attraktivität des europäischen Marktes steigt. Wer sich das dicht gestrickte Netz der Staaten ansieht, mit denen die EU bereits Freihandelsabkommen geschlossen und die einbezieht, die noch Schlange stehen, um mit solchen Verträgen die Union als Partner zu gewinnen, der muss erkennen, dass die Euro-Zone an Attraktivität gewinnt. Und mit ihr eine der stabilsten Währungen der Welt im der größten Wirtschaftsräume der Erde. Um den Euro muss einem nicht bange sein. Die Furcht vor einem Scheitern bleibt trotzdem angebracht, weil er eine kostbare Errungenschaft ist, um die es sich zu kämpfen lohnt.
von Detlev Drewes

Wie geht es weiter mit dem Euro? Im Zusammenspiel der Mitgliedsländer und unter dem Gesichtspunkt der Verschuldung einiger Staaten eine nicht immer leicht Aufgabe. Die EU muss zwischen den vielen Hürden hindurch. (Oliver Berg/dpa)