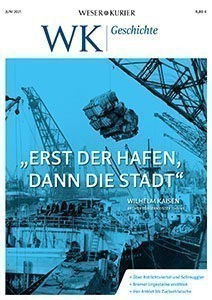Vor 170 Jahren erschienen „Bremen’s Volkssagen“ von Friedrich Wagenfeld / Als Fälscher einer phönizischen Geschichtschronik 1836/37 einen Skandal ausgelöst
Der Bremer Schriftsteller Friedrich Wagenfeld hatte eine lange Durststrecke hinter sich, als er 1844/45 endlich wieder einen Bestseller landen konnte: Mit der Publikation von „Bremen’s Volkssagen“ traf er den Nerv der Zeit. Ein glänzendes Comeback des Mannes, der einige Jahre zuvor als Fälscher einer phönizischen Geschichtschronik einen handfesten Skandal in der deutschen Gelehrtenwelt losgetreten hatte. Doch waren die „Volkssagen“ wirklich authentisch? Darüber streiten die Experten bis heute.
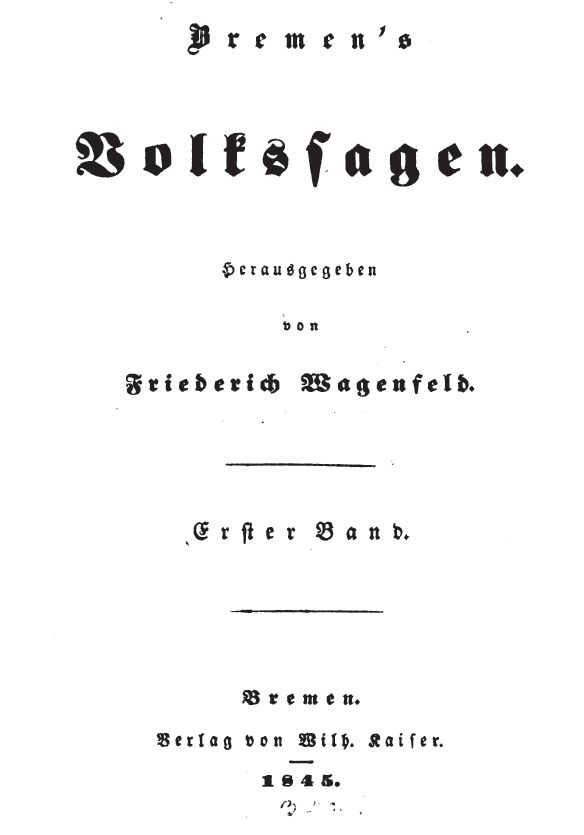
Ein Bestseller: das von Friedrich (hier fälschlich „Friederich“) Wagenfeld herausgebrachte Buch „Bremen’s Volkssagen“.
Quelle: Google
Wer kennt sie nicht, die Geschichte von den „Sieben Faulen“? Die Legende von den sieben Brüdern aus dem Stephaniviertel, die völlig zu Unrecht als Sinnbild der Faulheit gelten und der Faulenstraße ihren Namen gegeben haben sollen. Nur allzu leicht ist man versucht, die höchst unterhaltsame Mär als Überlieferung aus grauer Vorzeit zu betrachten, als unvergänglichen Bestandteil eines lokalen Sagenschatzes. Doch weit gefehlt, in Wahrheit ist der Stoff der Phantasie des Bremer Schriftstellers Friedrich Wagenfeld entsprungen. Erstmals veröffentlicht wurde der Text im August 1844 als Bestandteil von „Bremen’s Volkssagen“, die sukzessive in insgesamt sechs Heften erschienen. Vollständig ausgeliefert war das Werk dann Anfang 1845, mithin vor gut 170 Jahren – ein passender Anlass, sich ein wenig näher mit der Geschichte von den „Sieben Faulen“ wie auch den „Volkssagen“ zu befassen. Und natürlich mit dem Mann, der sie zu Papier gebracht hat.
Als der damals 34-jährige Wagenfeld mit den „Volkssagen“ reüssierte, war er alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Weit über Bremen hinaus hatte er 1836/37 mit der angeblichen Entdeckung eines Werks des phönizischen Geschichtsschreibers Sanchuniathon auf sich aufmerksam gemacht. Die Fachwelt stand Kopf, laut Wagenfeld hatte sich ein Manuskript in griechischer Übersetzung erhalten. Sogar renommierte Gelehrte schenkten ihm Glauben, allen voran der Altertumsforscher Georg Friedrich Grotefend aus Hannover. Als anerkannte Autorität seines Fachs hatte er keinerlei Bedenken, 1836 ein langes Vorwort zum Abdruck eines ersten Auszugs beizusteuern. Und Grotefend war nicht nur von der Echtheit der Handschrift überzeugt. Sondern legte auch seine Hand dafür ins Feuer, dass kein späterer Übersetzer den „treuen Bericht“ verfälscht habe.
Ein haarsträubender Irrtum, wie sich alsbald zeigen sollte. Weil sich die Publikation der angekündigten Sensationsentdeckung immer weiter verzögerte, mehrten sich die Stimmen der Skeptiker. In Bremen noch dadurch genährt, dass Wagenfeld seine Autorenschaft gar nicht in Abrede stellte. „Er äußerte sich selbst gegen Personen, die ihm nicht genauer bekannt waren, ganz ohne Rückhalt darüber, wie Alles nur seine Erfindung sei“, heißt es im Nachruf. Schon damals meinten Eingeweihte, er sei seines eigenen Blendwerks überdrüssig geworden und würde sich nur noch mit größtem Widerwillen die fehlenden Seiten aus den Fingern saugen. Als dann endlich die vollständige Fassung erschien, bedurfte es nur noch eines schlagkräftigen Beweises, um auch außerhalb der Hansestadt das Lügengebäude zum Einsturz zu bringen. Und den lieferte der Historiker Carl Ludwig Grotefend – der Sohn des Mannes, der Wagenfeld auf den Leim gegangen war.
Nach dem Skandal wüste Alkoholexzesse

Zu leichtgläubig: Der renommierte Altertumsforscher Georg Friedrich Grotefend (1775 bis 1853) verbürgte sich mit seinem guten Namen für Wagenfelds gefälschte Phönizier-Chronik.
Quelle: Wikimedia Commons
Als der Schwindel aufgeflogen war, wurde es still um Wagenfeld. Es heißt, er habe sich wüsten Alkoholexzessen hingegeben. Offenbar gar nicht einmal aus Frust über seine Entlarvung als Scharlatan, sondern aus Lust am Bohème-Leben.
Jahrelang soll er durch die Kneipen gezogen sein, mehrfach wechselte er seine Wohnung. Geboren im Stephaniviertel, lebte er eine Zeitlang als Hauslehrer in Brinkum, nach seiner Rückkehr nach Bremen im Schlachteviertel, dann in der Neustadt, schließlich wieder in der Altstadt. Vermutlich hielt er sich als Schreiber und mit journalistischen Gelegenheitsarbeiten über Wasser. Erst mit den „Volkssagen“ kehrte er 1844 zurück ins Rampenlicht der Öffentlichkeit.
Interessant ist, dass sich Wagenfelds fragwürdige Vergangenheit nicht negativ auf die Verkaufszahlen der „Volkssagen“ auswirkte. Das zeigt die umfangreiche Liste der Subskribenten. Denn die liest sich wie ein Who’s Who der feinen Bremer Gesellschaft. Unter den Abnehmern der „Volkssagen“ befanden sich laut Bernd Ulrich Hucker, Bearbeiter der Neuausgabe von 1996, so bekannte Persönlichkeiten wie Johann Smidt und Arnold Duckwitz. Die Kritik fiel euphorisch aus, der Bremer Bürgerfreund empfahl das Werk „jedem Bremer, vom Rathsmann bis zum Arbeitsmann“ als Lektüre. Nachdem der erste Band 1845 erschienen war, sollte sogar noch ein zweiter folgen – offenbar dürstete das Publikum nach neuen Sagen als Lesestoff. Der Skandal um das gefälschte Geschichtswerk spielte anscheindend keine Rolle mehr. Vielleicht herrschte sogar eine gewisse Vorfreude auf sein neues Erzeugnis. Das Enfant terrible von ehedem – jetzt endlich zurück auf der großen Bühne.
Woher der überwältigende Erfolg? Zu bedenken ist, dass Volksmärchen und Volkssagen damals hoch im Kurs standen. Man halte sich nur den Siegeszug der Gebrüder Grimm vor Augen. Was die beiden Gelehrten mit ihren ungemein populären Märchen- und Sagensammlungen im nationalen Rahmen vormachten, fand auch Nachahmer auf Länder- und regionaler Ebene. Ein Zufall war das keineswegs: Märchen und Sagen galten als des Volkes reine, unverfälschte Stimme. In dieser Zeit, als Deutschland noch kein Nationalstaat war, gab es einen starken Drang nach nationaler Selbstvergewisserung. Man wollte zurück zu den eigenen Wurzeln, wollte den „welschen Tand“ abstreifen. Da kamen die „Volkssagen“ gerade recht, sie entsprachen dem romantisch gefärbten Zeitgeist mit all seiner Mittelalter-Verliebtheit.
Konnte man Wagenfeld trauen?
Insofern schwamm Wagenfeld im Strom der Zeit, eine Sammlung Bremer Volkssagen hatte gute Aussichten auf günstige Aufnahme. Doch konnte man Wagenfeld wirklich trauen? Oder stand zu befürchten, dass er die Leserschaft abermals hinters Licht führen würde? Die Probe aufs Exempel hat Bernd Ulrich Hucker in seiner Neuausgabe der „Volkssagen“ gemacht. Akribisch listet er auf, aus welchen Quellen Wagenfeld seine Informationen schöpfte. Sein Fazit: „einige Stücke des ersten Bandes und fast alle des zweiten“ beruhten auf mündlicher Überlieferung.

Der Fehler seines Lebens: Georg Friedrich Grotefend steuerte das Vorwort zu Wagenfelds Geschichtsfälschung bei.
Quelle: Google
Also gute Arbeit, kein Betrugsverdacht?
So klingt zumindest, was Hucker zur „Ehrenrettung“ Wagenfelds vorzubringen hat. Doch ganz sauber ist seine Beweisführung nicht. Lässt er doch unter den Tisch fallen, dass von den 47 Beiträgen des ersten Bandes gerade einmal sechs auf mündlicher Überlieferung beruhen. Dass „fast alle“ Stücke des zweiten Bandes dieses Kriterium erfüllen, ist angesichts der Tatsache, dass er überhaupt nur 22 Beiträge enthält, keine wirkliche Entlastung. Bleibt festzuhalten: Von insgesamt 69 Beiträgen der „Volkssagen“ basieren nur 26 auf mündlicher Überlieferung, das ist etwas mehr als ein Drittel.
Das nährt den bösen Verdacht, Wagenfeld könnte als „Volkssagen“ deklariert haben, was dieser Gattung in Wahrheit gar nicht angehört. Ein Etikettenschwindel, um den Absatz seines neuen Werks zu erhöhen?
Hören wir, was Wagenfeld selbst dazu zu sagen hat. Im Vorwort seiner „Volkssagen“ macht er überhaupt keinen Hehl daraus, dass er seinen Stoff mitunter stark ausschmückte. Ganz offen distanziert er sich vom „wissenschaftlichen Sagensammler“. Und lässt wissen, er habe die Sache von einem „mehr heitern Gesichtspunkt“ aufgefasst. Was wohl heißen soll: Bei der Wiedergabe der alten Geschichten gestattete er sich mancherlei Freiheiten – vor allem, wenn sie nur fragmentarisch überliefert waren. In solchen Fällen habe er sich einen möglichen Zusammenhang schlichtweg ausgedacht, darin liege ohnehin „oft die meiste Poesie“. Eine Methode, die Wagenfeld als völlig legitim verteidigte. Dafür bedürfe es „keiner Rechtfertigung“, dafür glaube er auch „keinen Tadel zu verdienen“.
Eine kurze Notiz zu einer Sage von drei Seiten aufgeblasen
Zweifellos ein selbstbewusstes Statement. Doch das ändert nichts daran, dass Wagenfeld auch schriftlich fixierte, historisch verbürgte Vorgänge kurzerhand als Sagen ausgab. Um überhaupt einen vorzeigbaren Bremer Sagenschatz präsentieren zu können, bediente sich Wagenfeld relativ hemmungslos bei der alten Bremer Geschichtschronik des Notars Johann Renner und bei den sogenannten Nequamsbüchern, einer frei zugänglichen Kriminalstatistik. Teils begnügte sich Wagenfeld mit dürren Mehrzeilern, teils mussten kurze Mitteilungen als Stoff für neue Sagen herhalten. Hucker verweist auf ein paar Zeilen aus dem Nequamsbuch, die Wagenfeld zu einer Geschichte von drei Seiten aufblies. Wirklich seriös war das nicht mehr, auch wenn Wagenfeld sich damit rechtfertigte, er habe nur solche Notizen gewählt, die „einen Beitrag der Sittengeschichte und Meinungen unserer Vorfahren in der Sagenzeit liefern“.

Der Brunnen zur Geschichte: der Sieben Faulen-Brunnen von Bernhard Hoetger in der Böttcherstraße.
Foto: Frank Hethey
Wagenfelds Methoden brachten ihm posthum heftige Kritik ein. Nur vereinzelt stieß der Kunsthistoriker Gustav Friedrich Hartlaub auf „eigentlich Sagenhaftes“ in den „Volkssagen“, dazwischen stünden „höchst eigenartige, nur um einen schwachen Kern von Überlieferung frei herumgesponnene Erzählungen“. Sein ernüchterndes Fazit: „Also wahrhaftig keine Sammlung von Volkssagen!“
Besonders verärgert reagierte Hartlaub darauf, dass Wagenfeld die Geschichte von den „Sieben Faulen“ unter dem Banner der „Volkssagen“ segeln ließ. Empört konstatierte er, die sieben Faulen als Namensgeber der Faulenstraße habe Wagenfeld „nur erfunden, um seine Erzählung mit Fug in den Rahmen seiner Bremer Volkssagen einfügen zu können“.
Ein vernichtendes Urteil. Dabei sympathisierte er durchaus mit Wagenfeld, gerade die Geschichte von den „Sieben Faulen“ lobte Hartlaub als „überaus tiefsinnige Deutung der Idee des Fortschritts“. Denn dem Müßiggang huldigen die sieben Brüder nur in ihren jungen Jahren, später legen sie sich als innovative Landwirte mächtig ins Zeug. Ein feinsinniges Lehrstück über Menschen, die mutig ausgetrampelte Pfade verlassen – und über missgünstige Nachbarn, die den sieben Brüdern ihren Erfolg nicht gönnen und immer wieder unterstellen, jede Neuerung geschehe nur aus reiner Faulheit, um überflüssige Arbeit zu vermeiden.
Die „Sieben Faulen“ waren frei erfunden
Gerade die „Sieben Faulen“ zeigen, wie problematisch Wagenfelds Arbeitsweise ist. Denn so offenherzig er sich auch über die Quellen seiner Texte und sein eigenes Zutun äußerte, so unterschlug er dabei doch, dass einige Stücke wie „Die sieben Faulen“ frei erfunden waren. Faule Knechte oder Söhne und ihre Läuterung sind zwar ein gängiges Märchenmotiv, aber nicht in der Bremer Überlieferung. Somit können sie auch nichts zu tun haben mit der Herkunft des Namens Faulenstraße. Vielmehr leitet sich der Name vom schlechten („vulen“) Zustand der Straße her. Mit anderen Worten, Wagenfeld hat im wahrsten Sinne des Wortes ein Märchen erzählt. Ein sehr schönes und lehrreiches, daran besteht kein Zweifel. Aber dennoch eines, das entgegen eigener Angabe nicht auf lokaler Überlieferung beruht.

Auch nicht gerade ein Musterbeispiel authentischer Geschichtsdarstellung: Die „Kriegsfahrten der Bremer zu Wasser und zu Lande“ von 1846.
Quelle: Google
Fragt sich nur, warum Wagenfeld sich solche dichterischen Freiheiten erlaubte. Die Macht der Gewohnheit? Frei nach dem Motto: einmal Fälscher, immer Fälscher? Damit würde man es sich wohl zu einfach machen. Denn kriminelle Energie trieb ihn nicht an, Wagenfeld hatte von seinem Blendwerk keinen finanziellen Gewinn und strebte auch nicht danach.
Möglich, dass sein Verleger Wilhelm Kaiser ihn unter Druck setzte. Immerhin arbeitete Wagenfeld seit 1844/45 auch als Redakteur für dessen „Bremisches Unterhaltungsblatt“, als „Volksblatt“ eine boulevardesk aufgezogene Zeitung. Da konnte er Wagenfeld auch als Bestseller-Autor in die Pflicht nehmen. Mit den Sagen war nun einmal ein sagenhaftes Geschäft zu machen, das dürfte Kaiser schnell klar geworden sein. Das würde auch erklären, warum die Substanz mitunter sehr zu wünschen übrig ließ. Nicht anders als bei Wagenfelds letztem Werk, den in seinem Todesjahr 1846 wiederum in Kaisers Verlag veröffentlichten „Kriegsfahrten der Bremer zu Lande und zu Wasser“. Die Methode war die gleiche wie bei den „Volkssagen“: wieder ziemlich dürftige Quellen als Grundlage für ein Werk, das sich auf Kosten der Wahrheit gut verkaufen sollte.
Oft fließende Grenzen zwischen Dichtung und Wahrheit
Der Fairness halber ist zu sagen, dass Wagenfeld nicht der einzige war, der sich fragwürdiger Methoden bediente. Manch ein schwarzes Schaf tummelte sich im Literaturbetrieb, es gab mehr als nur einen Fälschungsskandal. Sogar die Gebrüder Grimm haben alte Überlieferungen gnadenlos ausgeschlachtet, die Grenzen zwischen Dichtung und Wahrheit waren oft genug fließend. Und nicht nur die Märchen- und Sagensammler hatten Erfolg beim Publikum, auch die Märchenerfinder erfreuten sich großer Popularität. Erinnert sei an den dänischen Dichter Hans Christian Andersen. Wahrscheinlich ist Wagenfeld irgendwo in diesem Spannungsfeld einzuordnen. Als ein Mann, der nichts dabei fand, sowohl alte Überlieferungen wiederzugeben als auch eigene Erzählungen im bewährten Gewand von Märchen und Sagen zu präsentieren. Und zwar ohne die geringste Spur eines schlechten Gewissens.
Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Seine Kritiker übersehen, dass Wagenfeld weit mehr war als ein skrupelloser Schreiberling. Tatsächlich kann man ihn auch als Medienkritiker sehen. Das hatte durchaus seine Berechtigung in einem Zeitalter massiven Wandels, der medialen Revolution. Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts gilt als Epoche der „Lese-Revolution“ – immer mehr Menschen konnten lesen, immer mehr Druckprodukte überschwemmten einen schier unersättlichen Markt. Mit seiner phönizischen Fälschung wollte Wagenfeld vielleicht einfach nur mal sehen, was geht. Und es ging einiges, die Fachwelt fiel ja gründlich herein auf seine angebliche Entdeckung. Damit war der Beweis geführt, wie trügerisch Nachrichten sein konnten im neuen Informationszeitalter. Wie leicht es möglich war, eine breite Öffentlichkeit an der Nase herumzuführen, sie praktisch nach Belieben zu manipulieren. Keine unwichtige Erkenntnis in einer Zeit, als die reaktionären Staatswesen den praktischen Wert von systematischer Irreführung und Desinformation erkannten. Die implizite Botschaft: Glaube nicht alles, was du liest.
Ein hochaktueller Ansatz.
von Frank Hethey

Der Sieben Faulen-Brunnen in der Böttcherstraße gehört zum Pflichtprogramm eines jeden Bremen-Touristen. Erstmals wurde die Legende von den sieben faulen Brüdern als Bestandteil von „Bremen’s Volkssagen“ 1844/45 veröffentlicht. Und basierten in Wahrheit nicht auf uralter Überlieferung, sondern waren eine Erfindung des Bremer Schriftstellers Friedrich Wagenfeld.
Foto: Frank Hethey